Ursprünglich wollte die amerikanische Notenbank die Zinsen in diesem Jahr viermal erhöhen – daraus wird nichts. Am Markt wird die Wahrscheinlichkeit, dass 2016 überhaupt noch etwas geschieht, augenblicklich sogar auf weniger als 50 Prozent veranschlagt. So wird jedenfalls das Protokoll der Sitzung vom 26. und 27. Juli interpretiert; es wurde am Donnerstag veröffentlicht. Andererseits spiegelt das Protokoll nicht wider, was sich inzwischen am Arbeitsmarkt, bei der Produktion und der Inflation getan hat. Am Dienstag haben jedenfalls zwei Präsidenten regionaler Fed-Banken, William Dudley von New York und Dennis Lockhart von Atlanta, durchblicken lassen, dass es 2016 durchaus eine oder sogar zwei Anhebungen der Fed Funds Rate geben könnte. Drei Meetings stehen noch aus.
Für die EZB und alle, die sich Sorgen machen wegen der Nebeneffekte der Nullzinspolitik, wäre das eine gute Nachricht. Der Druck, weitere expansive Maßnahmen auf den Weg zu bringen, ließe nach, der Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung rückte näher. In der Vergangenheit haben sich die Fed und die EZB zeitversetzt im Gleichschritt bewegt, wobei die Fed, als Notenbank der größeren Volkswirtschaft, stets voranging. Wie die Grafik zeigt, folgte die EZB unterschiedlich rasch, und zwar nach vier bis 17 Monaten.
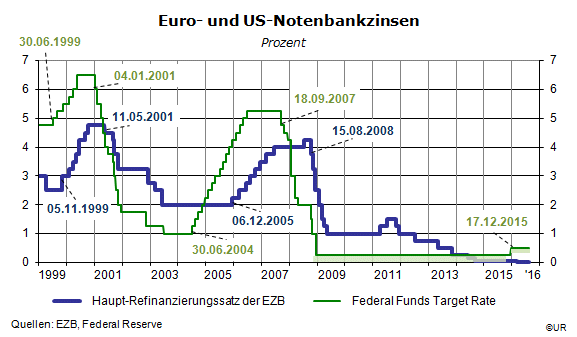
Die Geschichte muss sich nicht wiederholen, aber die Arbeitshypothese, dass sie es auch diesmal tut, hat einiges für sich. Wenn ich recht habe, könnte die EZB nach der letzten Rate ihres gigantischen Wertpapieraufkaufprogramms im März 2017 die Zinswende auch im Euroraum einleiten. Das wäre dann etwa 15 Monate nach der ersten Anhebung der Fed Funds Rate von Dezember 2015.
Zunächst ein Blick auf die wirtschaftlichen Aussichten in den USA und im Euroland.
Würde die amerikanische Wirtschaft höhere Zinsen vertragen? Am Arbeitsmarkt brummt es: Die Arbeitslosenquote ist seit ihrem Hoch von 9,9 Prozent im Dezember 2009 stetig auf zuletzt 4,9 Prozent gesunken, die breiter gefasste Unterbeschäftigungsquote von 17 auf 9,7 Prozent, während die Beschäftigung zuletzt um 2,0 Prozent über ihrem Vorjahresstand lag. Die durchschnittlichen Stundenlöhne waren im Juli um 2,6 Prozent höher als zwölf Monate zuvor und steigen damit deutlich rascher als in den fünf Jahren zuvor (wenn auch nicht so rasch wie in Deutschland!). Das Einzige, was stört, ist die nach wie vor sehr niedrige Beschäftigungsquote: Sie hat sich zwar zuletzt etwas erholt, beträgt aber nur 62,8 Prozent und ist damit mehr als drei Prozentpunkte niedriger als vor der Finanzkrise. Nicht alle Mitglieder des Offenmarktkommittees der Fed würden daher von Vollbeschäftigung sprechen.
Das Wirtschaftswachstum lässt sehr zu wünschen übrig – im ersten Halbjahr war das reale BIP mit einer annualisierten Rate von nur 1,0 Prozent gestiegen. Ein Aufschwung sieht anders aus. Zudem sind die Ausgaben für Kapitalgüter rückläufig, ebenso wie die Produktivität. Wären höhere Zinsen da nicht so etwas wie eine kalte Dusche?
Was die amerikanische Inflation angeht, übertrafen die Verbraucherpreise ihren Vorjahreswert zuletzt nur um 0,8 Prozent, so dass der Zielwert von zwei Prozent nach wie vor in weiter Ferne ist. Für die Geldpolitiker ist die Kernrate der privaten Konsumausgaben jedoch der relevantere Indikator, weil er Komponenten ausschließt, die gewöhnlich stark schwanken – er gilt als Frühindikator dafür, wohin sich die Inflation bewegen wird. Immerhin schwankt er im Vorjahresvergleich seit sechs Monaten um die Marke von 1,6 Prozent, aber: Er will sich bislang nicht so richtig auf die zwei Prozent zubewegen.
Und das heißt? Ein richtig überzeugendes Argument für einen Zinsschritt im September gibt es nicht. Wenn sich das Wirtschaftswachstum aber im dritten Quartal beschleunigen sollte und die Beschäftigung weiter mit monatlichen Werten von 200.000 zunimmt, könnte es am 2. November so weit sein, passenderweise sechs Tage vor den Präsidentschaftswahlen.
In der Währungsunion spricht im Augenblick nur wenig dafür, dass sich die EZB einem Zinsschritt der Fed anschließen kann. Die Lage ist aber auch nicht so hoffnungslos, wie das manchmal dargestellt wird. Kaum jemandem ist aufgefallen, dass die Anzahl der neuen Jobs kräftig zunimmt – im ersten Quartal übertraf sie ihren Vorjahresstand immerhin um 1,4 Prozent. Leider reicht das nicht für einen rascheren Abbau der Arbeitslosigkeit. Im Juni betrug die Quote immer noch 10,1 Prozent. Wenn es so weitergeht wie zuletzt, wird es fünf Jahre dauern, bis die Vollbeschäftigungsmarke von 5 Prozent erreicht ist. Dabei liegt die Jugendarbeitslosigkeit immer noch bei 20,8 Prozent. Die Situation am Arbeitsmarkt ist das größte Risiko für den Fortbestand des Euro.
Bei der europäischen Inflation tut sich etwas! Nicht, dass wir jetzt schon die Quittung für die monetäre Expansion bekämen, aber einige Indikatoren haben sich zuletzt in die gewünschte Richtung bewegt: die Lohnkosten übertrafen im ersten Quartal ihren Vorjahreswert um 1,7 Prozent (im vierten Quartal waren es nur 1,3 Prozent); die Einfuhrpreise haben seit März mit einer Verlaufsrate von 2,4 Prozent zugelegt; die Erzeugerpreise im Verarbeitenden Gewerbe mit einer von 3,3 Prozent und der harmonisierte Verbraucherpreisindex in den vergangenen sieben Monaten mit einer Rate von 2,5 Prozent. Dass der HVPI im Juli im Vorjahresvergleich nur bei 0,2 Prozent lag, heißt nicht, dass er nicht Anfang 2017 knapp zwei Prozent erreichen könnte – nur wenn der Ölpreis erneut stark fällt und sich der Euro nachhaltig aufwertet, wird es dazu nicht kommen. Jedenfalls ist die Deflation erst einmal kein Thema mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die EZB im kommenden Frühjahr von den Preisen her Spielraum für einen ersten Zinsschritt haben wird.
Die Kapitalmärkte sollten sich darauf einrichten. Am europäischen Bondmarkt wird es durch die Zunahme der Inflationserwartungen und die steigenden Geldmarktsätze zu Verlusten kommen. Wenn die Anleger damit rechnen, dass sich der Satz für den dreimonatigen EURIBOR auf seinem Gleichgewichtswert von etwa 3 Prozent (ein Prozent reales BIP, zwei Prozent mittelfristige Inflationsrate) einpendeln wird, dürften sie für zehnjährige Bundesanleihen eine Rendite von vielleicht vier Prozent verlangen. Das entspricht von heute an einem Kursverlust von etwas mehr als 40 Prozent. Sie werden daher schon früher versuchen, auf kürzere Laufzeiten umzusteigen. Je nachdem, wie plötzlich sich die Erkenntnis durchsetzt, dass die EZB die Zügel anziehen wird, dürfte es zu einem mehr oder weniger reibungslosen Prozess kommen. Das ist aber nicht ausgemacht.
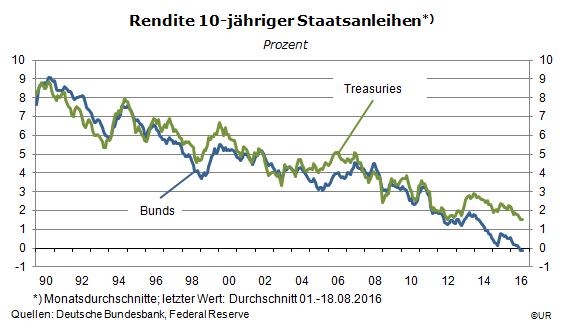
Noch gefährlicher ist die Lage am Aktienmarkt. Wegen des Anlagenotstands ist es zu übertriebenen Bewertungen gekommen. Das Kurs-/Gewinnverhältnis auf der Basis der zuletzt publizierten Gewinne je Aktie beträgt beim EuroStoxx 50 nicht weniger als 22,6, beim DAX 24,0. Beides ist weit über Normal. Wenn die Inflation also tatsächlich in Richtung 2 Prozent anzieht, werden die Anleger auf einer Risikoprämie bestehen, die viel höher ist als heute. Durchschnittliche Kursverluste von über einem Viertel sind dann nicht auszuschließen.
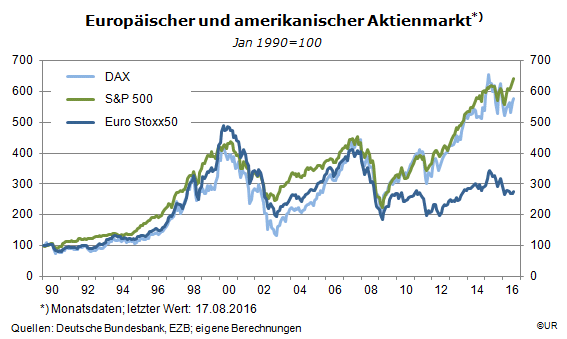
All das ist keine Katastrophe, sondern vielmehr ein überfälliger Normalisierungsprozess, an dessen Ende der Finanzsektor vermutlich kleiner, dafür aber stabiler sein wird.
Zum Schluss will ich noch einmal klarstellen, dass ich zwei zentrale Annahmen mache – die sich als falsch herausstellen können: dass sich die europäische Inflation nachhaltig, wenn auch moderat beschleunigt, und dass die Fed wegen der günstigen Lage am Arbeitsmarkt im November oder Dezember die Zinsen erhöhen wird, gefolgt von einer Serie weiterer Anhebungen.