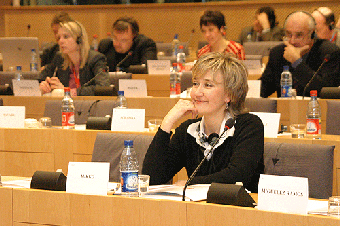Das Krisenjahr 2010 hat die Europa-Politik härter und ehrlicher gemacht
Es ist eines dieser blauen Büros. Die Tür ist blau. Die Aktenordner sind blau. Das Indigo des Teppichs erscheint zwar schon ein bisschen gebleicht. Aber umso frischer strahlt dafür das Hemd des Bürobewohners, türkis, unterstrichen von einer Krawatte, azur. Der Mann, der sie trägt, ist einer von jenen Brüsselanern, dessen Nachnamen-Kombination keine eindeutigen Rückschlüsse auf seine Herkunft zulässt. Eben so wenig wie seine Sprache; er beherrscht drei wie seine eigene. Ganz gewiss hat dieser Mann nichts dagegen wenn wir ihn, um die Dinge abzukürzen, einfach „die Europäische Kommission“ nennen.
„Wir sind keine Aliens“, stellt die Europäische Kommission nach ein paar einleitenden Sätzen klar. „Wir wurden geschaffen, um den Interessen der EU-Mitgliedsstaaten zu dienen.“ Deswegen sei es ganz und gar nicht schlimm, wenn Angela Merkel eine neue Europapolitik betreibe. Wenn sie sich zum Beispiel zweimal überlege, unter welchen Bedingungen sie einem 750-Milliarden-Paket zur Stützung des Euros zustimme. Oder wenn sie in Brüssel auftrete wie eine gestrenge Gouvernante, die von anderen Staatschefs Hausaufgaben einfordert, weil sie Schluss machen will mit Schlendrian und Mauschelei. „Ich kann Merkels Position im vergangenen Krisenhalbjahr absolut nachvollziehen“, sagt die Europäische Kommission.
Tatsächlich? Aber Merkel, ja Deutschland insgesamt, scheint die Liebe zu Europa zu verlieren.
„Wir brauchen keine Liebe“, antwortet die Europäische Kommission.
Wirklich nicht?
„Nein. Aber was wir brauchen, ist das Bewusstsein, dass das europäische Interesse auf lange Sicht das Interesse aller Mitgliedsstaaten ist. Auch das Deutschlands.“ Die europäische Kommission macht eine nachdenkliche Miene. Dann geht sie zum Wandschrank und zieht einen Bogen mit Umfragewerten heraus. „Es herrscht ein unglaubliches Maß von Euroskepsis in vielen Ländern. Wir müssen besser erklären, warum die EU den Bürgern nutzt.“ Allen voran Angela Merkel, soll das heißen, muss das tun, wenn sie Schaden verhüten wolle.
Brüssel im Sommer 2010. Ein Halbjahr liegt hinter der EU-Hauptstadt, dessen Folgewirkungen auf das Wir-Gefühl des Kontinents noch nicht abzusehen sind – nur eine ist es schon: Europa fühlt sich deutlich kühler an zu diesem Saisonende. Deutschland, bisher der verlässlichste Motor der Integration, hat mit Stottern und Rumpeln überrascht. Nicht nur stellten die Germanen nur plötzlich harte Bedingungen für ihre Solidarität mit den Schwachen der Union. Angela Merkel erweckt bei vielen Brüsseler Beobachtern auch den Anschein, die Völkerunion eher widerwillig zu managen statt sie mit Herzblut voranzutreiben.
„Sankt Helmut konnte ja auch hart sein“, sagt Giles Merritt, der Präsident des Brüsseler Elite-Zirkels Friends of Europe, unter Anspielung auf die integrationsgläubige Generation Kohl. „Aber die traditionelle Überzeugung lautete doch, dass Deutschland von Europa profitiert, dass der Binnenmarkt integral ist für seinen wirtschaftlichen Erfolg.“ Was ist los mit Euch?, fragt Merritt, habt ihr das vergessen? Hat sich die politische DNA Deutschlands so verändert?
„Zu einer Solidargemeinschaft gehört nach unserer Ansicht, dass die Mitglieder ihre Pflichten erfüllen. Wir müssen alle besser werden. Aber einige müssen mehr besser werden als andere“, beschreibt ein ranghohes Regierungsmitglied die Gegenleistung, welche die Bundesregierung für ihren Beitrag zur Euro-Rettung erwartet. 23 Milliarden Euro stellte Berlin als Kredite für Griechenland bereit, noch einmal 120 Milliarden flossen in die (bisher nicht gebrauchte) 750-Milliarden-Stützungsreserve für den gesamten Euro-Raum.
Aber hätte ein Helmut Kohl heute wirklich anders gehandelt als eine Angela Merkel? Hätte nicht auch er gefordert, die Euro-Zone regelfester zu machen und mehr Klartext zu reden? Der ehemalige Diplomat Wilhelm Schönfelder hat die deutsche Europapolitik seit den siebziger Jahren mitgestaltet, als Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt und später, bis 2007, als EU-Botschafter in Brüssel. Einen grundlegenden Wandel, rekapituliert er, habe die deutsche EU-Politik schon nach 1989 vollzogen. „Ausdrückliche Nachfragen darüber, ob diese oder jene europäische Initiative eigentlich im deutschen Interesse liege, gab es nach dem Fall der Mauer immer häufiger“, erinnert sich Schönfelder. Das sei doch auch ganz logisch.
Schönfelder nimmt ein Blatt Papier und zeichnet zwei Achsen darauf. „Das hier“, sagt er und zeigt auf die horizontale, „ist die Summe der Mitgliedsländer. Erst 6, dann 12, jetzt 27. Und das hier“, er zeigt auf die vertikale, „ist der Grad der Komplexität von Brüsseler Entscheidungen.“ Schönfelder zeichnet langsam eine Verlaufskurve in das Koordinatensystem ein. Sie zieht sich steil, fast senkrecht nach oben. „Das heißt, die Möglichkeit, dass ein Mitgliedstaat Probleme hat und ,nein’ sagt, ist dramatisch gestiegen.“ Mal kann es Polen sein, das seinen Streit mit Russland über Fleischexporte in die EU hinein zieht. Mal Frankreich, das seine eigene Mittelmeerunion gründen will. In einer doppelt so großen EU, kurzum, fühlen sich alle auch ungefähr doppelt so berechtigt, auf ihre Interessen zu pochen.
Am kräftigsten von allen Kanzlern fuhr Gerhard Schröder die Ellenbogen gegen Europa aus. 1999 bremste er Brüssel bei dem Versuch aus, Autohersteller zur Rücknahme von Schrottfahrzeugen zu verpflichten – VW & Co. hätte diese Richtlinie Milliarden gekosten. Und aus Angst vor polnischen Klempnern und bulgarischen Krankenschwestern, die in den deutschen Sozialstaat einwandern könnten, bestand Schröder nach der Osterweiterung der EU 2004 und 2007 auf ausgedehnten Übergangsfristen für die Freizügigkeit der Neuropäer.
Auch Merkel hat heute ein Erfolgsmodell verteidigen, wenn sie das Brüsseler Ratsgebäude betritt. Die Bundesrepublik, so sieht sie es, hat sich mit der Agenda 2010 einer Sozialreform unterzogen, die andere EU-Länder scheuten. Das Berliner Grundgefühl gegenüber der Wohngemeinschaft Europa lautet, kurzum, nicht mehr Scham. Eher schon Stolz, gemischt mit Trotz.
Als vor wenigen Wochen eine Gruppe ausländischer EU-Korrespondenten Berlin besuchte, erklärte ihnen Bundesinnenminister Thomas de Maizìere, das neue deutsche Selbstbewusstsein sei kein Grund zur Beunruhigung. „Für Europa ist die Stärke, mit der Deutschlands Interessen verteidigt werden, vielleicht neu“, sagte er. Aber würde, fragte er die Journalisten, eine solche Linie nicht als natürlich betrachtet werden, wenn sie Frankreich, Italien oder Großbritannien verträten?
Viele Europäer im Brüsseler Institutionen-Kosmos sehen das genau so. „Merkel steht nicht allein“, sagt Janis Emanouilidis. Der Deutsch-Grieche arbeitet am Brüsseler European Policy Centre und kennt die Einschätzungen aus beiden europäischen Hemisphären, Nord wie Süd. „Österreicher, Niederländer und Skandinavier finden ja auch, dass manches schief läuft am Mittelmeer. Aber sie lehnen sich nicht so aus dem Fenster. Weil Merkel es für sie tut.“
Die EU hatte sich, anders gesagt, eingerichtet in unausgesprochenen Differenzen. Es war höchste Zeit, so denken viele in Brüssel, dass es damit ein Ende hatte. Auch deswegen nimmt Pierre Moscovici, der Vize-Vorsitzende des Europaausschusses im französischen Parlament, die Deutschen in Schutz: „Politik kann doch nicht von Schuld, schlechtem Gewissen oder Großzügigkeit bestimmt sein, es muss um das Beste für das Land gehen.“ Verfolgten schließlich nicht auch Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi oder José Zapatero eigennützige Motive?
Und doch. In blauen Büros bleibt eine zähe Sorge zurück nach diesem Halbjahr. Was, lautet sie, kommt nach der neuen deutschen Nüchternheit? Man muss es ja nicht Liebe nennen, was die EU zum Leben braucht, sagt die europäische Kommission. „Aber natürlich funktioniert Europa nur, wenn es mit einem gewissen Herzblut verfolgt wird.“ Wird dieses Herzblut jetzt sogar in Deutschland stockig, wird es manchem bange, wie es weitergeht.
Denn dass die Emotion völlig versiegt als Treibstoff für Europa, das gab es noch nie. Mit einiger Nervosität schauen Europas Mandarine deshalb auf die zweite Hälfte dieses Jahres. In ihr beginnen die Verhandlungen über den kommenden EU-Haushalt. Dass Deutschland, wie bisher, geneigt sein wird, der größte Nettozahler der Union zu bleiben, das bezweifeln nach diesem Frühjahr immer mehr von Brüssels Blauhemden.
 Natürlich hat Angela Merkel den Mann nicht in erster Linie wegen seiner europapolitischen Kompetenzen nach Brüssel verfrachtet. Aber wer die Anhörung des künftigen EU-Energiekommissares Günther Oettinger heute vormittag im Europaparlament verfolgte, gewann dann doch einen überraschenden Eindruck. Der Begriff des schnellen Brüters, schien es nach dem dreistündigen Kandidatentest, muss ganz neu definiert werden.
Natürlich hat Angela Merkel den Mann nicht in erster Linie wegen seiner europapolitischen Kompetenzen nach Brüssel verfrachtet. Aber wer die Anhörung des künftigen EU-Energiekommissares Günther Oettinger heute vormittag im Europaparlament verfolgte, gewann dann doch einen überraschenden Eindruck. Der Begriff des schnellen Brüters, schien es nach dem dreistündigen Kandidatentest, muss ganz neu definiert werden.