Heute gab es die deutschen Inflationszahlen für den Februar: Die Verbraucherpreise (HVPI) waren um 1,2 Prozent höher als vor einem Jahr, nach 1,4 Prozent im Januar, so dass es für Euroland insgesamt ebenfalls zu einer Inflationsrate von 1,2 Prozent, wenn nicht sogar von 1,1 Prozent kommen dürfte. Diese Zahlen gibt am Mittwoch.
Das 2-Prozent-Ziel der EZB ist wieder ein bisschen weiter in die Ferne gerückt. Höhere Leitzinsen sind daher nur vorstellbar, wenn Mario Draghi demnächst eingesteht, dass das Ziel auf absehbare Zeit nicht erreichbar ist, während sich gleichzeitig infolge der Nullzinsen gefährliche Aktienblasen bilden, die es zu bekämpfen gilt. Damit ist aber nicht zu rechnen. Auch wenn das vielen Sparern nicht gefällt, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist die lockere Geldpolitik genau das Richtige.
Hauptgrund ist die nach wie vor katastrophale Lage am Arbeitsmarkt. Wenn ich, wie das Bloomberg auf der Basis von Eurostat-Daten macht, zu den 14,6 Mio. offiziellen Arbeitslosen diejenigen hinzuzähle, die arbeiten könnten, aber nicht aktiv auf der Suche sind (6,2 Mio.), dazu die Jobsucher, die aus verschiedenen Gründen nicht sofort eine Arbeit aufnehmen können (1,6 Mio.), sowie die Teilzeitbeschäftigten, die gern in Vollzeit arbeiten würden (6,6 Mio.), komme ich auf eine Unterbeschäftigung von nicht weniger als 29 Millionen Personen. Das entspricht einer Quote (der sogenannten U-6) von 17,1 Prozent an der Erwerbsbevölkerung! Für die Mittelmeerländer Italien, Spanien und Griechenland weist Bloomberg Werte zwischen 23 und 28 Prozent aus.
In den vergangenen, konjunkturell eigentlich immer erfreulicheren Jahren ist die Gesamtquote nur um etwa einen Prozentpunkt pro Jahr zurückgegangen. Daher verwundert es nicht, dass der Euro in vielen Teilen der Währungsunion nicht als etwas Tolles wahrgenommen wird und von den sogenannten populistischen Parteien mit euroskeptischen Aussagen Stimmen gewonnen werden können. Um es noch klarer zu sagen: Wenn es nicht wenigstens eine berechtigte Hoffnung auf so etwas wie Vollbeschäftigung gibt, kann der Euro auf Dauer nicht überleben.
Das Ausmaß der Unterbeschäftigung lässt sich, wie ich das in der Vergangenheit gelegentlich getan habe, auch durch die Lücke zwischen aktuellem und potenziellem BIP darstellen. Niemand sonst macht das so, aber man braucht nur anzunehmen, dass die Finanzkrise zu keinem echten Bruch im Potenzialwachstum geführt hat – warum auch? –, dass es also mit der Vorkrisenrate von 1,9 Prozent im Jahr weitergegangen ist. Dann ergibt sich für das vierte Quartal 2017 eine Outputlücke von nicht weniger als 12,2 Prozent. Das erklärt auf ziemlich überzeugende Art, warum die Löhne trotz des kräftigen Anstiegs der Beschäftigung (1,5 Prozent p.a. in den vergangenen beiden Jahren) auf Stundenbasis zuletzt nur um 1,5 Prozent höher waren als im Jahr zuvor, und ohne dass eine Beschleunigung zu erkennen ist.
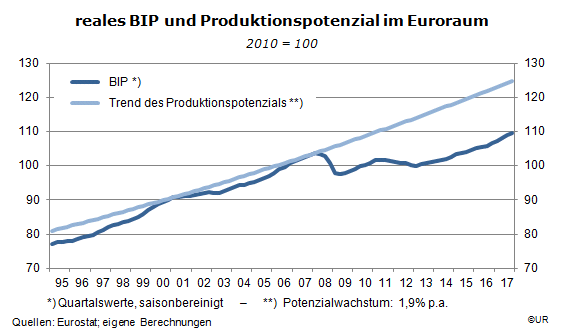
Mario Draghi sieht das neuerdings ähnlich. Am Montag hatte er vor dem europäischen Parlament Folgendes gesagt: „Wir wissen nicht genau, wie groß die ungenutzten Kapazitätsreserven sind. Sie sind möglicherweise in Wahrheit größer als geschätzt, was wiederum verhindern könnte, dass sich ein Druck auf die Preise entwickelt. Dies macht sich insbesondere auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar, wo die Lohninflation trotz der starken Beschäftigungszunahme nur sehr moderat ist.“ (meine Übersetzung aus dem Englischen)
Wenn es nach der EZB ginge, könnte die Geldpolitik also so expansiv bleiben wie sie ist. Starkes Wirtschaftswachstum in Verbindung mit negativen oder sehr niedrigen Realzinsen ist nicht nur gut für die Beschäftigung, sondern auch für die Staatsfinanzen, insbesondere in den Problemländern. Die niedrigen Zinsen haben im Übrigen den erwünschten Nebeneffekt, dass der Euro nicht so stark aufwertet, so dass der Tendenz nach vom Außenhandel weiterhin positive Impulse auf die Konjunktur ausgehen können.
Wie erwähnt, besteht das größte Risiko darin, dass sich sogenannte Vermögensblasen bilden. Auf der Suche nach Renditen, die höher sind als das, was sich mit Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen zur Zeit verdienen lässt, haben Anleger die Aktienkurse, Ölpreise und in einigen Ländern auch die Immobilienpreise stark in die Höhe getrieben.
Problematisch ist das nur dann, wenn sie das vorwiegend mit geliehenem Geld getan haben. Wenn nämlich die Kurse und Preise eines Tages einbrechen, sind diese Anleger rasch überschuldet und sind dann gezwungen, ihre Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen einzuschränken – womit sie die nächste Rezession auslösen könnten. Vor allem in Frankreich ist das eine Gefahr, insgesamt aber ist die Verschuldung des privaten Sektors etwas niedriger als vor der letzten Finanzkrise. Ich kann nur hoffen, dass die europäische Bankenaufsicht anders als beim letzten Mal die Verschuldungsrisiken im Griff hat.