Viele freundliche Worte wurden gewechselt bei der Stabübergabe von Jean-Claude Trichet an Mario Draghi, eins aber wurde nicht gesagt: dass die EZB ein deutlich erweitertes Mandat braucht. Es reicht nicht, allein für Preisstabilität verantwortlich zu sein und, wenn das geschafft ist, auch noch etwas für die Konjunktur zu tun. So wie die Krise des Euro gerade eskaliert, wird es nicht mehr lange dauern, bis die EZB die Finanzierung der italienischen und spanischen Haushaltsdefizite übernehmen muss. Diese Aufgabe war bisher nicht vorgesehen.
Kein Rettungsschirm wird jemals über so viel Geld verfügen wie die EZB, zumal die Steuerzahler in den potenziellen Gläubigerländern zu streiken beginnen und weitere Vergrößerungen ablehnen. Im Übrigen kann ein Rettungsmechanismus auch nur dann funktionieren, wenn Frankreich auf der Geberseite bleibt. Die Märkte haben da aber ihre Zweifel. Im Augenblick ist der Renditeabstand zu Deutschland bei zehnjährigen Staatsanleihen auf 1,20 Prozentpunkte geklettert. Wenn die griechische Regierung mit der Ankündigung einer Volksabstimmung über die neuen Sparmaßnahmen Ernst macht und es zu einem „Nein“ kommen sollte, also etwa 350 Milliarden Euro abzuschreiben sind, wird die Rekapitalisierung der französischen Banken, die bekanntlich besonders stark exponiert sind, die finanziellen Reserven Frankreichs erschöpfen und zu einer Herabstufung seines Ratings führen.
Das wäre de facto das Ende der European Financial Stability Facility (EFSF), denn Deutschland und die vier anderen Länder mit einem Triple-A-Rating sind auch zusammen zu schwach, um für all die potenziellen Verbindlichkeiten der anderen zu bürgen. Wenn der Euro überleben soll, was die meisten Leute im Euroland immer noch für richtig halten, muss die EZB auch offiziell die Rolle des Kreditgebers der letzten Instanz einnehmen, so wie die Fed oder die Bank von Japan es tun. Sie ist in der Lage, Staatsanleihen zu Renditen aufzukaufen, die nicht höher, oder jedenfalls nicht viel höher sind als die, zu denen sich der Bund refinanziert.
Damit die Sache nicht ausartet und zu einem Selbstbedienungsladen wird, muss Zug um Zug eine Instanz geschaffen werden, die die Länder, die am Tropf der EZB hängen, zwingt, ihre Finanzen dauerhaft in Ordnung zu bringen. Geld darf es nur gegen solche Auflagen geben. Der EFSF würde sich vermutlich zu einer solchen Instanz weiterentwickeln. Die Holländer befürworten schon seit einiger Zeit einen „Budgetkommissar“ für die 17 Euroländer, mit Durchgriffsrechten auf die nationalen Haushalte. Er wäre der erste wirkliche Finanzminister der Währungsunion. Je mehr Macht er hat, desto günstiger wären die Konditionen, zu denen sich der EFSF (oder ihre Special Purpose Vehicles) verschulden können. Die Schützenhilfe durch die EZB würde dann im Laufe der Zeit nicht mehr nötig sein, das Gelddrucken hätte ein Ende.
So furchterregend, wie es manchmal dargestellt wird, ist dieses Gelddrucken in der jetzigen Situation allerdings keineswegs. Ob die Bilanz der EZB durch Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken – so wie bisher üblich – oder durch Ankäufe von staatlichen Neuemissionen ausgeweitet wird, macht kaum einen Unterschied, jedenfalls was den Geldschöpfungsprozess angeht. In Japan ist die Zentralbank seit vielen Jahren routinemäßig am Primärmarkt tätig. Es gibt hier aber natürlich ein sogenanntes Moral Hazard-Problem, also die Versuchung, sich billig Geld zu beschaffen, aber es mit der Budgetdisziplin nicht so ernst zu nehmen. Daher geht es in der Tat nicht ohne einen strengen Budgetkommissar.
Einen erheblichen Anteil an der Schaffung der heutigen Probleme könnte man natürlich der EZB selbst zuschreiben. Sie hat zum Einen nicht verhindert, dass sich in Spanien oder Irland Immobilienblasen bildeten, oder dass sich die Verbraucher in einigen Ländern übermäßig verschulden konnten, oder dass sich die Qualität der Bankbilanzen stark verschlechterte (vielfach durch Auslagerung von Risiken in Special Purpose Vehicles irischer Provenienz). Sie hatte allerdings zugegebenermaßen nicht die Instrumente und Kompetenzen, hier risikomindernd einzugreifen. Immer noch galt ja die Ideologie, dass es einerseits keine systemgefährdenden Blasen geben könne – weil die Märkte zum Gleichgewicht tendierten -, und dass es andererseits kein Problem sei, den Kollateralschaden nach ihrem Platzen mit den herkömmlichen Instrumenten zu beseitigen.
Das war ein fataler Fehlschluss. Erstens ist es möglich, gefährliche Übertreibungen an den Märkten für Immobilien, Aktien oder Rohstoffen zu identifizieren. Ich habe darüber vor zwei Jahren hier im Blog geschrieben. Blasen ließen sich also verhindern, wenn nur der Wille dazu vorhanden wäre. Zum anderen ist es sehr schwierig, gelegentlich sogar unmöglich, eine Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, die an den Folgen geplatzter Vermögensblasen laboriert (siehe Schaubild).
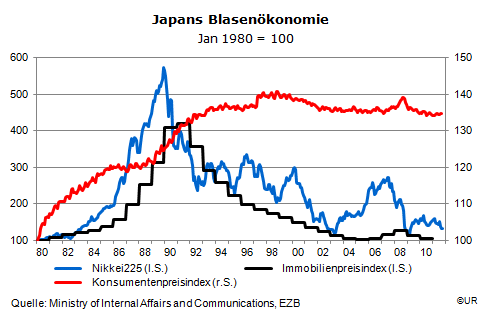
Die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, ist eine mehr oder weniger lösbare Aufgabe: Die Stellschrauben heißen Zinspolitik, Mindestreservesätze und Expansionsrate der Zentralbankgeldmenge. Wenn aber Haushalte, Banken und sonstige Unternehmen nur eines im Sinn haben, nämlich ihre Schulden zu vermindern, nachdem sie sich in der vorangegangenen Euphorie Geld für Dinge geliehen hatten, die später stark an Wert verloren haben, dann droht Deflation. Japan lässt grüßen. Und bei den Geldpolitikern herrscht in einer solchen Situation Ratlosigkeit: Die Zinsen dürfen ja nach der heutigen Lehrmeinung nicht unter null Prozent gesenkt werden, und zum Anderen läuft selbst eine aggressive Expansion der Notenbankbilanz ins Leere, wenn kein Mensch neue Schulden machen will.
Dass das Preisniveau auch einmal für längere Zeit sinken kann, war im Vertrag von Maastricht nicht vorgesehen, ist aber heute keine von weit her geholte Möglichkeit mehr. Um es dazu gar nicht erst kommen zu lassen, müssen Schuldenexzesse und Blasenbildungen verhindert werden. Auch dazu braucht die EZB neue Instrumente und Befugnisse. Sie muss in der Lage sein, direkter als bisher in den Kreditvergabeprozess der Banken einzugreifen, beispielsweise durch Variation der Eigenkapitalanforderungen, der Eigenbeteiligung bei Hypothekenkrediten, oder der „margin requirements“ bei Derivategeschäften, vielleicht auch durch direkte Kreditkontrollen. Wie eine moderne Notenbankpolitik aussehen sollte, darüber sollten sich im Übrigen scheuklappenfreie Ökonomen dringend Gedanken machen. Das Versagen der EZB ist auch ein Versagen ihrer Vordenker.
Zu diesem Thema empfehle ich die Lektüre eines BIS Working Papers von Claudio Borio mit dem Titel „Central banking post-crisis: What compass for uncharted waters?“ vom September dieses Jahres. Der Autor gehört zusammen mit seinem Mentor William White zu den Volkswirten, die schon frühzeitig darauf hingewiesen hatten, dass Preisstabilität nicht das einzige Kriterium für eine Notenbank sein kann, und dass die Vermögenseffekte nicht unterschätzt werden dürfen.