Italien könnte das neue Griechenland werden. Gemessen an den notleidenden Krediten im Bankensektor oder an der Verschuldung des Staates steht das Land ähnlich schlecht da wie der Nachbar auf der östlichen Seite der Adria, nur dass es um ganz andere Größenordnungen geht. Seit Jahren herrscht Rezession, aber es ist wegen der Auflagen von Maastricht nicht möglich, eine expansive Finanzpolitik zu betreiben; eine Abwertung ist ebenfalls ausgeschlossen. Konjunkturpolitisch gibt es kaum Spielraum, und bis Strukturreformen greifen, geht immer viel Zeit ins Land. Dennoch: Die Anleger vertrauen nach wie vor darauf, dass die Krise nicht auf systemgefährdende Weise eskalieren wird, sonst läge die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen nicht bei nur 1,2 Prozent und damit in der Nähe ihres Rekordtiefs. Weil der italienische Staat als guter Schuldner gilt, hat es anders als in Griechenland im Zuge der Eurokrise keine zweistelligen langen Zinsen gegeben.
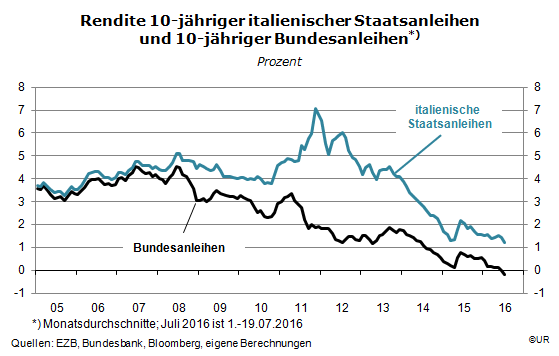
Italienische Aktien werden allerdings seit einiger Zeit nur mit spitzen Fingern angefasst. Vor allem die Banken sind schwer unter Druck.
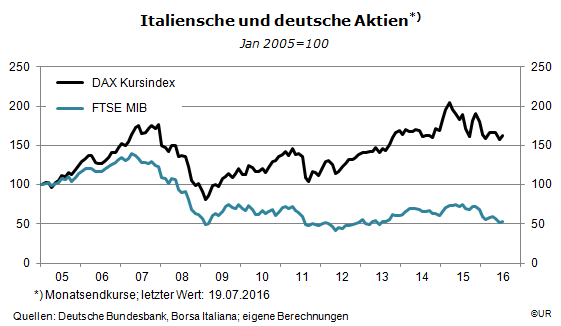
Viele von ihnen müssten wegen Kapitalmangels sofort ihren Betrieb einstellen, wenn sie ihre notleidenden Kredite marktgerecht bewerten würden. Ende 2015 betrugen die Kredite an private Haushalte und nicht-finanzielle Unternehmen rund 1,5 Billionen Euro, wovon nach Angaben der Banca d’Italia 0,35 Bill. Euro notleidend waren – das entspricht 21,3 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts und übertrifft die Kapitalpuffer der Banken um ein Vielfaches. Italien hat nicht nur zu viele Banken, die meisten von ihnen sind auch unterkapitalisiert. Die Krise von 2008/2009 wurde nicht genutzt, den Sektor zu bereinigen und die überlebenswürdigen Banken auf eine solide finanzielle Basis zu stellen. Das rächt sich jetzt.
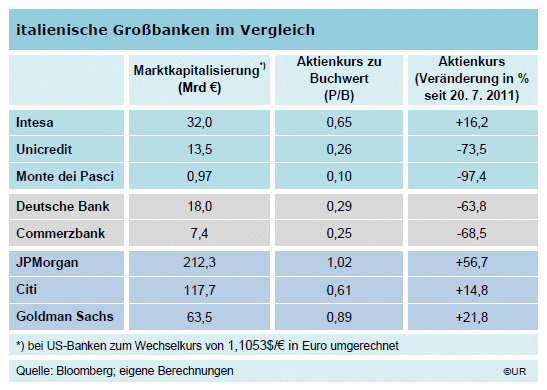
Wenn bei einer Bank das Verhältnis zwischen Aktienkurs und dem Buchwert je Aktie niedriger ist als Eins, schafft das Management aus der Perspektive des Marktes keinen Mehrwert. Je näher der Bruch der Nulllinie kommt, desto mehr lohnt es sich, die Bank zu zerschlagen und die Einzelteile zu verkaufen, oder sie zu übernehmen (was auf das Gleiche hinausläuft). Am kritischsten ist die Situation bei Monte dei Pasci di Siena, wo der Aktienkurs gerade mal ein Zehntel des Buchwerts ausmacht. Die Unicredit – mit ihren 124.000 Beschäftigten die größte Bank des Landes – kommt auf den fast genauso mageren Wert von 0,26.
Eine kleine Abschweifung: Hierzulande ist es kaum besser. Die Deutsche Bank und die Commerzbank, die beiden verbliebenen deutschen Großbanken, stehen, wie die Tabelle zeigt, fast genauso schlecht da wie die italienischen. Welten trennen die Banken Eurolands im Übrigen von ihren amerikanischen Konkurrenten, auch das zeigt die Tabelle. Es ist an der Zeit, dass das nationale Kleinklein aufhört und die Bankenunion vollendet wird, einschließlich einer gut ausgestatteten Abwicklungsinstitution (besser allerdings eines gemeinsamen Finanzministeriums) und einer länderübergreifenden Einlagensicherung. Aus Sicht der Steuerzahler ist es besser, wenn es keine nationalen Champions mehr gibt, nicht nur aus Risikogründen, sondern weil Banken aufgehört haben, ein Wachstumssektor zu sein. Dafür sorgen die flachen und niedrigen Renditekurven, die strengeren Kapitalanforderungen sowie die Konkurrenz aus dem Internet.
Warum halte ich die Situation der italienischen Banken für beherrschbar? Zunächst einmal sind notleidende Kredite nicht dasselbe wie drohende hundertprozentige Verluste. Ein großer Teil besteht aus Hypotheken, und die sind stets durch Immobilien abgesichert, die sich verkaufen lassen. Das geht oft nicht schnell und zu den gewünschten Preisen, aber es geht. Die Aufsichtsbehörden, einschließlich der EZB, werden die Banken zwingen, ihre Bilanzen durch den Verkauf von unterbewerteten Aktiva zu sanieren und andere Aktiva auf ein marktgerechtes Niveau abzuschreiben.
Im Gegenzug dürfte es eine Rekapitalisierung geben, entweder durch die Emission von Aktien und langfristigen Schuldverschreibungen, soweit das noch geht, oder durch den Rettungsfonds Atlante, der kürzlich unter staatlichem Druck von Banken, Versicherungen und Investmentfonds geschaffen wurde. Dieser Fonds hilft den Banken auch dabei, notleidende Kredite zu verkaufen. Der Staat selbst darf sich offiziell nach den neuen europäischen Richtlinien nicht mehr an einem bail-out kriselnder Banken beteiligen und hat das offenbar auch nicht vor. Vermutlich wird es aber Ausnahmen geben, wenn die finanzielle Stabilität eines Tages ernsthaft gefährdet sein sollte. Darüber hinaus gibt es ja für diesen Fall auch noch eine europäische Institution wie den ESM, den European Stability Mechanism, der Banken direkt rekapitalisieren kann, allerdings nur unter Auflagen, denen die italienischen Regierung nachkommen müsste.
Die bevorzugte Methode für die Rettung von Banken ist nach den Vorgaben des BRRD, der Bank Recovery and Resolution Directive, das sogenannte bail-in der nachrangigen Gläubiger: Sie müssten bei einem solchen Verfahren auf einen Teil ihrer Ansprüche verzichten, oder bekämen für ihre Forderungen Anteile am Aktienkapital. Politisch ist das eine heikle Sache, weil davon nicht zuletzt viele private Haushalte betroffen wären, die insgesamt Bankanleihen von etwa 200 Mrd Euro halten und diese bisher für absolut sicher gehalten hatten. Es ist inzwischen klar, dass sie nicht richtig über die Risiken dieser Papiere aufgeklärt worden waren: Vor allem Kleinanleger müssten daher vor Verlusten geschützt werden. Für Premierminister Renzi ist das ein Muss, weil er sonst mit großer Sicherheit das Verfassungsreferendum verlieren würde, das im Oktober stattfinden soll. Eine weitere Maßnahme, die die Regierung auf den Weg gebracht hat, besteht darin, die Konkursverfahren europäischen Normen anzupassen und so den Verkauf notleidender Kredite zu erleichtern.
Insgesamt gibt es noch viel Spielraum auf der Kostenseite der italienischen Banken: Sie haben große Überkapazitäten und entsprechend niedrige Erträge. Ohne Fusionen wird es nicht gehen, auch nicht ohne größere Entlassungen, was angesichts einer Arbeitslosenquote von 11,6 Prozent nicht leicht zu vermitteln sein wird (die Jugendarbeitslosigkeit betrug im Mai nicht weniger als 36,9 Prozent).
Vieles ist also auf den Weg gebracht, was eine katastrophale Eskalation der italienischen Bankenkrise verhindern wird. (siehe dazu auch den jüngsten Beitrag von Nicolas Véron: Italy’s Banking Problem Is Serious But Can Be Fixed) Die Reformen waren längst überfällig, jetzt werden sie notgedrungen endlich in Angriff genommen. Glücklicherweise ist der Staat trotz des hohen Schuldenstands (130 Prozent des BIP) finanziell einigermaßen gesund; sein aggregiertes Haushaltsdefizit dürfte in diesem Jahr minus 2,5 Prozent des BIP erreichen und damit unter der Maastrichter Schwelle von drei Prozent bleiben. Außerdem weist die Leistungsbilanz einen beträchtlichen Überschuss auf: Das Land ist daher ein Nettoexporteur von Kapital und vermindert so seine Schulden gegenüber dem Ausland.
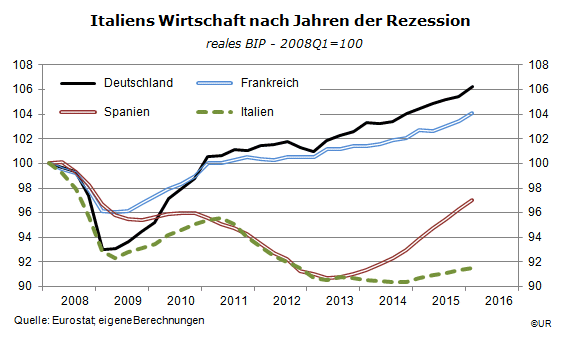
Ein gutes Ende wäre noch wahrscheinlicher, wenn sich die Konjunktur in den übrigen Ländern des Euroraums auch nach dem Brexit weiter erholen würde. Die Bankenkrise ist nicht zuletzt durch die jahrelange Rezession ausgelöst worden. Herr Schäuble ist hier der Hauptadressat – vielleicht kann er seine sinnlose „schwarze Null“ mal für eine Weile vergessen.