Am Markt wird erwartet, dass Mario Draghi am Donnerstag noch einmal draufsatteln wird, und wenn nicht dann, dann bei einer der folgenden Pressekonferenzen. Nach einer Umfrage bei Bloomberg erwarten die Analysten, dass die EZB zusätzliche expansive Maßnahmen ergreifen wird: Für am wahrscheinlichsten halten sie eine Verlängerung des Anleiheankaufsprogramms über den März 2017 hinaus, gefolgt von einer weiteren Senkung des Einlagesatzes, einer Aufstockung der langfristigen Kreditprogramme, einer Senkung des Hauptrefinanzierungssatzes von Null auf einen negativen Wert, einer Aufstockung der monatlichen Bondkäufe auf über 80 Mrd. Euro und – jetzt kommt’s – einer Ausweitung des Ankaufsprogramms auf neue Assetklassen.
Stehen uns neue „unkonventionelle“ Maßnahmen ins Haus? Wird die EZB demnächst auch Aktien in ihre Bilanz nehmen? Japan macht es bereits vor: In ihrem jüngsten Monatsbericht schreibt die Bundesbank, dass die Bank von Japan „das jährliche Kaufvolumen von börsengehandelten Indexfonds auf rund 6 Billionen Yen (rd. 53 Mrd. €) annähernd zu verdoppeln“ plane (S. 41). Auch Thomas Mayer hat in seiner FAS-Kolumne am Sonntag vor einer Woche unter der Überschrift „Vorsicht vor den Notenbankern!“ darauf hingewiesen: Nachdem diese uns bereits die Niedrigzinsen „eingebrockt“ hätten, drohten jetzt Eingriffe in den Aktienmarkt.
Aktien könnten eine Alternative sein, weil die Kurse der Bonds schon so hoch und ihre Renditen nominal und real so niedrig beziehungsweise sogar negativ sind. Wenn es weiter in diese Richtung geht, könnte es für die Banken und den gesamten Finanzsektor bald ans Eingemachte gehen. Sie haben schon jetzt große Probleme.
Für Aktien spricht die Größe des Marktes. Ich schätze, dass die Kapitalisierung des EuroStoxx 600 knapp fünf Billionen Euro beträgt. Er wäre damit etwa halb so groß wie der gesamte Bondmarkt Eurolands. Sollte die EZB signalisieren, dass sie an Indexprodukten interessiert ist, würde es nicht an entsprechenden Angeboten der Banken fehlen. Es könnte sich ein überaus liquider Markt für diese ETFs (Exchange Traded Funds) entwickeln, obwohl das aus der Sicht der EZB ein nicht so wichtiger Aspekt wäre – weil sie ja nicht handeln, sondern vielmehr ihre neuen Assets erst einmal behalten würde. Dass die Dividendenrendite zur Zeit 3,55 Prozent beträgt, ist ebenfalls kein geldpolitisch relevanter Aspekt, würde aber die nationalen Finanzminister, also die Eigentümer der EZB freuen. Entscheidend dürfte sein, dass ein Umsteigen auf Aktien den Abwärtsdruck auf die Bondrenditen vermindern würde. Das wäre ein Beitrag zur Stabilisierung des europäischen Finanzsektors.
Die folgende Tabelle zeigt, dass deutsche, französische, spanische und niederländische Aktien, gemessen an der sogenannten Risikoprämie, nicht teuer sind. Italien ist die einzige Ausnahme. In der Vergangenheit lag die Prämie meist in einer Spanne von drei bis sieben Prozentpunkten. Je höher sie ist (im Vergleich zu „risikolosen“ langfristigen Bonds), desto billiger und damit attraktiver sind die Aktien. Die Risikoprämie lässt sich auch auf andere Weise berechnen, indem man nämlich zur aktuellen Dividendenrendite die erwartete reale Zuwachsrate der Dividenden addiert – die Ergebnisse der beiden Methoden sind vergleichbar.
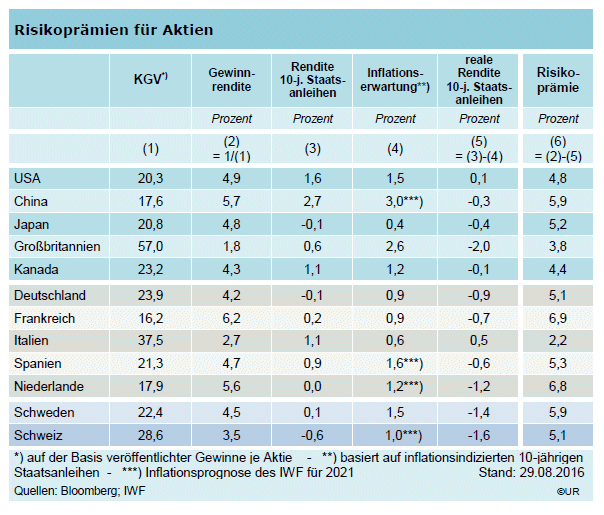
Die EZB und die anderen Notenbanken, die ihre Bilanzen verlängern möchten und jetzt angeblich auch über Aktienkäufe nachdenken, würden also relativ gesehen nicht zu viel bezahlen. Vielmehr würden sie dazu beitragen, die relativen Preise von Bonds und Aktien zu normalisieren. Das fällt zwar nicht unter das Mandat von Notenbanken, wäre aber dennoch ein willkommener Nebeneffekt. Vermutlich würden allerdings die Aktienkurse durch diese „Normalisierung“ stark steigen. Wenn allein die aktuell hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisse als Maßstab für die Bewertung herangezogen werden, sind Aktien eben doch nicht gerade billig – sie sind nur billig im Vergleich zu den Anleihen. Es droht die Gefahr einer Kursblase. In gewisser Weise führt ein Umsteigen von Bonds auf Aktien dazu, dass zwar an der einen Stelle verhindert wird, dass sich eine Blase gefährlich vergrößert, dass aber an anderer Stelle eine neue entsteht. Ein ziemliches Dilemma.
Warum gelten Aktienkäufe von Zentralbanken bislang als tabu? Im Grunde hat die EZB mit dem Ankauf von Unternehmensanleihen (seit Juni 2016) bereits eine rote Linie überschritten. Sie senkt tendenziell deren Renditen, subventioniert damit, an den Banken vorbei, den Unternehmenssektor oder, genauer, den Teil davon, der in der Lage ist, solche Anleihen zu begeben. Es ist klar, dass sie damit alle anderen Firmen diskriminiert. Selbst wenn sie nur Instrumente erwirbt, die einen ganzen Aktienmarkt abbilden (so wie etwa ETFs), benachteiligt sie die Firmen, die nicht in dem betreffenden Index vertreten sind, insbesondere aber auch die, die sich vorwiegend auf Bankkredite verlassen. Dass die Notenbanken nicht auf Hauptversammlungen als Aktionärin auftreten dürften, macht die Sache nicht besser.
Im Übrigen verändern alle Ankaufprogramme von Wertpapieren wegen der Kursgewinne die Vermögensverteilung zugunsten der Besitzer dieser Wertpapiere, also zugunsten der Wohlhabenden. Sie dürfen daher zu keiner Dauereinrichtung werden. Für Fragen der Vermögensverteilung ist die nationale Finanzpolitik zuständig, nicht die Zentralbank.
Aktienkäufe durch Notenbanken, als Ersatz für Bondkäufe, sind daher insgesamt höchst problematisch und nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich halte einen solchen Strategiewechsel für überflüssig.
Was spricht im Übrigen dafür, dass die EZB und die anderen Notenbanken aufhören sollten, noch mehr Bonds zu kaufen? Sind die Anleihekurse bereits jetzt fundamental nicht mehr zu rechtfertigen? Haben wir es also mit Blasen zu tun? Die Notenbanken müssten gegenhalten und alles unterlassen, was die Kurse weiter in die Höhe treibt. Alle Blasen platzen eines Tages.
Womöglich ist eine „Blase“ am Rentenmarkt aber gar nicht so gefährlich. Wer hat schon einmal von Finanzkrisen gehört, die durch zu niedrige Bondrenditen ausgelöst wurden? Reinhart und Rogoff haben für ihr flächendeckendes Krisenbuch „This Time Is Different“ (Princeton 2009) hunderte von Finanzkrisen untersucht, erwähnen aber keine einzige, bei der zu niedrige kurz- oder langfristige Zinsen das Problem waren. Der Grund: Bondkäufe werden nur in geringem Maße durch Kredite finanziert, so dass es nicht viele Anleger gibt, die bei einem Kurseinbruch überschuldet wären und mit aller Macht durch sparsames Wirtschaften ihre Schulden verringern müssten. Das ist bei Bonds anders als bei den typischerweise kreditgetriebenen Blasen in den Märkten für Immobilien, Aktien oder Rohstoffe. Eine Rezession als Folge von „Deleveraging“ ist bei einer Bondblase auf den ersten Blick kein so großes Risiko.
Wer kauft schon Bonds? Institutionelle Anleger wie Versicherungen, Pensionskassen oder Investmentfonds nehmen keine Kredite auf, sondern legen nur an, was ihnen an Geld zufließt. Notenbanken wie die EZB oder die Fed, die inzwischen über gewaltige Bondportefeuilles verfügen, können definitionsgemäß nicht in ihrer eigenen Währung überschuldet sein. Die einzige wichtige Ausnahme sind die Banken. Sie betreiben „Fristentransformation“ und können durch einen Anstieg der Leitzinsen ins Schleudern kommen – da vor allem viele europäische Banken weiterhin Bilanzprobleme haben, würde ihnen ein Kurseinbruch am Bondmarkt wehtun. Die Bankenkrise könnte erneut eskalieren.
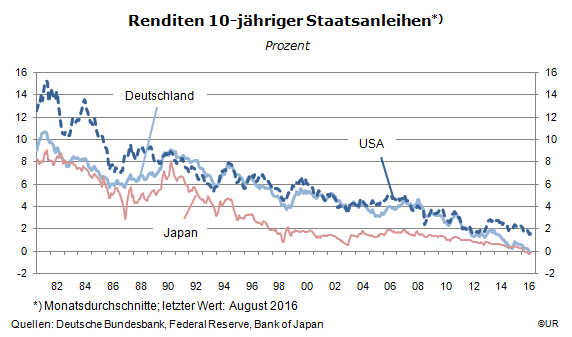
Auf Dauer werden aber bei weiter rückläufigen Bondrenditen auch die Versicherer und Pensionskassen Probleme bekommen. In dem Maße wie sie fällig werdende höher rentierliche Papiere durch solche mit sehr niedrigen oder sogar negativen Renditen ersetzen, müssen sie ihre expliziten und impliziten Renditeversprechen gegenüber ihren Kunden zurücknehmen und verlieren dadurch an Attraktivität. Und sie müssen ihre Kostenbasis verringern, also Leute entlassen oder schlechter bezahlen.
Es spricht daher Einiges dafür, den Verfall der Bondrenditen zu stoppen. Aber können Zentralbanken das überhaupt verhindern? Durch die Ankaufsprogramme haben sie tendenziell dazu beigetragen, dass die nominalen Renditen am langen Ende gesunken sind und die Zinskurve flacher geworden ist (die Banken können nicht mehr so viel damit verdienen, sich billiges kurzfristiges Geld zu leihen und höher verzinsliche längerfristige Mittel zu verleihen). Klar, wenn ein großer Käufer im Markt ist, treibt das die Kurse und senkt die Renditen. Die EZB kauft zurzeit jährlich netto etwa viermal so viele Anleihen wie die Mitgliedsstaaten netto Schulden aufnehmen! Wenn die Ankäufe eines Tages beendet werden, wird das sicher die Bondrenditen erhöhen.
Aber die langen Zinsen sinken nicht nur wegen der starken Nachfrage nach Bonds. Ebenso wichtig, vielleicht wichtiger, ist die Angebotsseite. Seit vielen Jahren sind die Zuwachsraten der gesamtwirtschaftlichen Produktivität rückläufig. Die Industrieländer verlieren zusehends an Dynamik, und das schlägt sich in sinkenden realen Bondrenditen nieder.
Normalerweise sind die realen Renditen von Staatsanleihen etwas höher als die erwarteten mittelfristigen Wachstumsraten des realen BIP, die in reichen Industrieländern seit einiger Zeit zwischen ein und zwei Prozent liegen. An den Rentenmärkten geht es aber alles andere als normal zu: Der durchschnittliche Realzins für 10 Jahre beträgt für die zwölf Rentenmärkte in der obigen Tabelle ungewichtet etwa -0,7 Prozent, BIP-gewichtet etwa -0,3 Prozent. Das sieht tatsächlich nach einer Blase aus. Und wer ist dafür verantwortlich? Die expansive Geldpolitik ist das Eine, die pro-zyklische Fiskalpolitik das Zweite und das Phänomen der säkularen Stagnation das Dritte. Schwer zu sagen, was der wichtigste Grund ist. Wenn der Renditeverfall gestoppt werden soll, muss in allen drei Bereichen angesetzt werden.
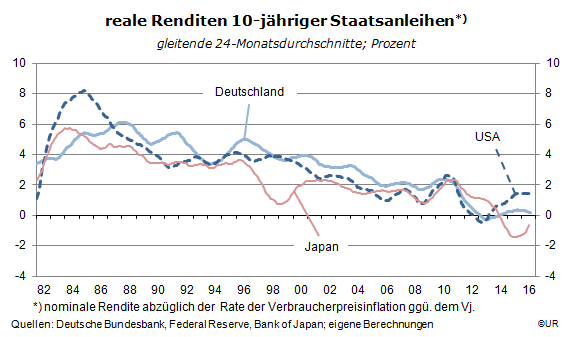
Bei dem Rückgang der realen Anleiherenditen handelt es sich um einen Megatrend, gegen den die Notenbanken oft nicht viel ausrichten können. Wie das folgende Schaubild zeigt, waren die Renditen der 10-jährigen US-Treasuries nach dem Ende des Ankaufsprogramms QE1 höher als zu Beginn. Das Gleiche passierte im Verlauf von QE2 und QE3; seit dem Herbst 2014, dem Ende von QE3, hat das Federal Reserve System seine Bilanzsumme mehr oder weniger konstant gehalten, die Renditen sind jedoch von damals 2,4 Prozent auf jetzt 1,6 Prozent gefallen. Es sieht danach aus, als ob die Fed mit ihren Ankaufsprogrammen nicht viel gegen die Fundamentals ausrichten kann. Vermutlich gilt das auch für die anderen Notenbanken. Sie kämpfen gegen Windmühlenflügel.
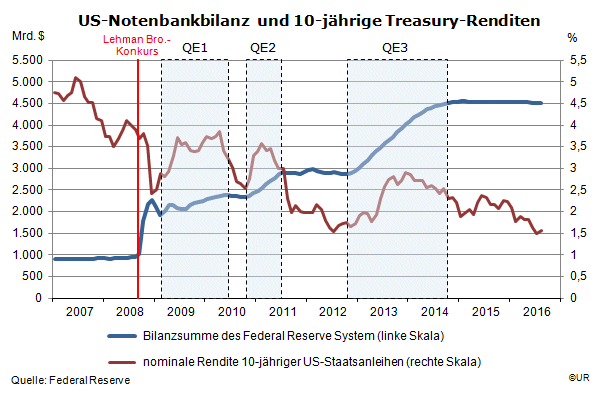
Im Grunde wird es nur dann wieder zu höheren realen und nominalen Bondrenditen kommen, wenn sich das Wirtschaftswachstum nachhaltig beschleunigt, wenn die ungenutzten Kapazitäten durch Nachfrageimpulse seitens des Staates und der privaten Haushalte endlich verschwinden (bei Freihandel ist das natürlich leichter gesagt als getan) und sich wieder eine Wachstums- und Inflationsmentalität durchsetzt. Das erfordert aber einen Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik.
Die Schlussfolgerung lautet: Die Notenbanken haben einen gewissen Einfluss auf die Bondrenditen, aber eben nur einen gewissen. Am Ende zählt vor allem, wie es mit der Produktivität weitergeht. Wer von Zinsen leben will, muss dafür sorgen, dass das Sozialprodukt wieder stärker expandiert – sonst geht es an die Substanz.