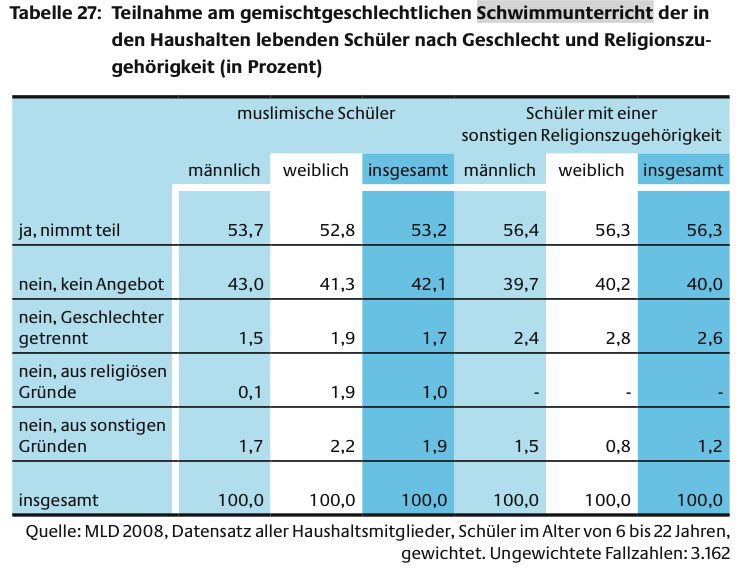Ein absolut verblüffender, mitreißender, bemerkenswerter Artikel von Hakan Turan. Er ist ja hier kein Unbekannter. der Stuttgarter Studienrat und Privatgelehrte (theoretische Physik, Mathematik, Theologie). Hier schreibt er zur aktuellen Debatte und ihren Auswirkungen auf die muslimisch-deutsche Identitätsbildung im Land. Ein leidenschaftliches Plädoyer, sich von einer aggressiven Stimmung nicht in eine Opfer-Identität drängen zu lassen, offen für Selbstkritik zu bleiben und sich die Liebe zu Deutschland nicht ausreden zu lassen. Toll.
Auszüge (der ganze Text ist lesenswert):
„Von vielen muslimischen Bürgern – auch von jenen, die als integriert und säkular gelten – ist in solchen Zeiten zu hören, dass sie sich schon seit langem nicht mehr so türkisch, muslimisch oder einfach nur fremd in Deutschland gefühlt haben. Auch wenn dies emotional nachvollziehbar ist – ist das im Grunde nicht eine Fluchtreaktion? Eine Reaktion, die alles, wofür zahllose Deutsche wie Türken seit Jahrzehnten gemeinsam gearbeitet haben, auf einen Schlag für gescheitert erklärt?
(…) An mir selbst erkenne ich z. B. Folgendes: Bis vor wenigen Jahren hatte ich mich im Kontext Islam fast ausschließlich mit eher theoretischen Themen befasst, sprich mit Fragen der Metaphysik, der Erkenntnistheorie und den Möglichkeiten einer Integration von Islam und Moderne. Die gesellschaftliche Realität da draußen samt ihren Problemen im Zusammenleben und der gegenseitigen Wahrnehmung ihrer Bürger kannte ich zwar gut – aber irgendwas hinderte mich lange daran dazu schriftlich Stellung zu beziehen. Da war offensichtlich eine internalisierte Zensur am Werk.
Im türkischen Umfeld – so ist zumindest mein Eindruck – wird die öffentliche ideelle Auseinandersetzung mit der deutsch-türkischen Lebenswirklichkeit in Deutschland oftmals gemieden. Dahinter steckt meist die Angst massiv angefeindet zu werden, oder zu viel von einer eventuell türkisch-zentrierten Weltanschauung aufgeben zu müssen. Aber dieses Konzept des Meidens und Ignorierens kann für die Zukunft der jungen Generation keine Option mehr sein.
(…)
Auch wenn ich weiß, dass es auch andere Erfahrungen gibt, die nicht minder ernst genommen werden dürfen als meine: In meinem Umfeld mache ich fast nur positive Erfahrungen mit Deutschen aus allen Altersstufen und Gesellschaftsschichten, selbst in Zeiten schärfster Islam- und Integrationskritik. Und das seit vielen Jahren. Nie hat jemand von mir verlangt, dass ich meine Wurzeln und persönlichen Überzeugungen verleugne. Ich wiederum akzeptiere die Deutschen so, wie sie sind, versuche ihre Sichtweisen nachzuvollziehen und bringe der deutschen Kultur, die ich zu großen Teilen auch als meine Kultur ansehe, den gebührenden Respekt entgegen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn türkischstämmige Freunde von ähnlichen positiven Erfahrungen berichten. Ausgerechnet in den Tagen der Sarrazin-Debatte meinte eine junge Muslimin mit Kopftuch zu mir, dass sie Zeit ihres Lebens fast nur positive Erfahrungen mit Deutschen gemacht hätte.
(…)
Es geht vielen Deutschen meist nur um bestimmte inhaltliche Aspekte der öffentlichen Stimmungsmacher, die sie für berechtigt halten – Aspekte, die selbst ich und die meisten Türken in meinem Umfeld zu manchen Teilen für berechtigt halten. Da stellt sich die Frage: Warum engagieren wir uns nicht für die Beseitigung dieser Probleme? Warum bekämpfen wir nicht selbst Missstände in der türkisch-islamischen Community, sondern warten darauf, bis sich Hetzer darauf stürzen und diese für ihre erbärmliche Propaganda instrumentalisieren? Wir wissen selbst sehr wohl, welche Traditionen und Islamkonzepte unvernünftig oder verwerflich sind. Lasst uns also den Islamkritikern mit Analysen und Lösungen zuvorkommen!
Ja, die Mehrheit der Deutschen ist nicht islamfeindlich, sondern aus nachvollziehbaren Gründen islamskeptisch. Folglich sollten auch wir nicht die Rolle des Opferkindes einnehmen, sondern die des geduldigen Zuhörers und des entschiedenen Vermittlers. Ich bin bereit für meine vermittelnde, aber in beide Richtungen bestimmte Haltung zu lernen, zu streiten, und auch eigene Meinungen aufzugeben, wenn sie sich als falsch erweisen.
(…)
Wir müssen jedoch akzeptieren, dass unsere in Entwicklung befindlichen Lebenskonzepte nicht erst von allen Seiten applaudiert und beglaubigt werden müssen, damit sie gut und legitim sind. Selbstbewusstsein definiert sich zu großen Teilen aus dem Vermögen sich selbst die Bestätigung dafür zu geben, dass das, was man nach reiflicher Abwägung tut, in Ordnung ist. Dass man als Mensch vor Gott und seinem Gewissen gerechtfertigt ist. Und dass man nicht als verunreinigter Schuldiger auf die Absolution durch das Tribunal von deutschen oder türkischen Kultur-, und Identitätswächtern warten muss.
Wir allein sind das Tribunal! Jeder über sich selbst!“
(Dank an Claudia Dantschke für den Tip)