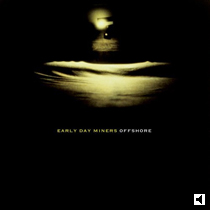Sie können singen, dass einem schummrig wird; ihre Melodien sind sperrig. Auf „Visible Forms“ bringen Audrey aus Schweden den Herbst zum Klingen
Zaudernd setzt das Klavier ein, synthetisches Züngeln mischt sich darunter. Das Schlagzeug stapft los, gedämpft wie von frischem Laub. Und diese Stimmen! Klar und voller Wehmut. Sie kommen näher, schleichen sich heran: hereinspaziert in die ersten Klänge von Visible Forms, dem Debüt von Audrey.
Vor vier Jahren gründeten Anna Tomlin, Emelie Molin, Victoria Skoglund und Rebecka Kristiansson die Band in dem kleinen Ort Henån, auf einer Insel bei Göteborg. Sie machen sparsamen Folk mit sperrigen Melodien.
Durch ihre neun Lieder ziehen sich immer wieder lange Instrumentalpassagen. Verträumtes Klavierklimpern ufert jäh aus in Gelärm, der Cellobogen webt dazu warme Töne in den Klangteppich. Ein geordnetes Gefühlschaos. Bedächtig setzen sie Ton an Ton. Nie klingen die Stücke überladen.
Dazu singen die vier, dass einem ganz schummrig wird. Mühelos schweben sie die Oktaven hinauf, hängen über der Musik. Hier vierstimmig gehaucht, gesummt, dort aus vollen Kehlen. Manchmal ein wenig scheu. Und immer so verführerisch.
Dann verdunkelt sich die Stimmung plötzlich. Trompetenstöße tröten einen durchgeknallten Stegreifjazz. Das Cello zirpte eben noch, nun schnarrt es vor Groll. Der Synthesizer knistert. Unheimliches Rascheln legt sich über die Musik. Etwas Dräuendes naht. Und Audrey flüstern ängstlich: „Catch your last breath, it’s coming“, immer wieder. Der Takt von Treacherous Art beschleunigt, treibt den Hörer minutenlang durch düstere Klaviersätze. Dann endlich die Lichtung. Trauer hat sich in die Stimmen gemogelt. Sie klingen, als schluckten sie ein paar Tränen. Fern bläst ein Flügelhorn körnige Fanfaren. Der Tag bricht an. Von hell zu dunkel dauert es bei Audrey nur ein paar Trommelschläge.
Beinahe alle Lieder haben etwas Erhabenes. Nur der Beginn von Six Yields stampft mit donnernden Paukenschlägen voran, man möchte mitwippen, da wird es mal rockig für ein paar Minuten. Wenn man aber genau hinhört, dann hört man ihn schon wieder: diesen Chor vom Verlassenwerden. Melancholie kann so zauberhaft klingen.
„Visible Forms“ von Audrey ist erschienen bei Sinnbus
Hören Sie hier ![]() „Mecklenburg“
„Mecklenburg“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie FOLK
Markku Peltola: „Buster Keaton Tarkistaa Lännen Ja Idän“ (Klangbad 2006)
Victory At Sea: „All Your Things Are Gone“ (Gern Blandsten 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik