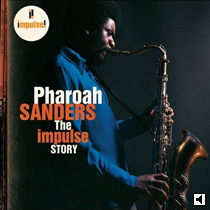Der Pianist Michael Wollny liebt Schauergeschichten. Seine erste Solo-CD „Hexentanz“ klingt düstern, spannend, entrückt, ganz wie die Romane von Sir Arthur Conan Doyle
Wenn man ihn in seiner Dachwohnung im Kreuzberger Chamisso-Kiez besucht, kommt man dem Titel seiner neuen CD Hexentanz schnell auf die Schliche. Auf dem Flügel liegt ein Adorno-Buch, an der Wand hängt ein Plakat für den Film A Clockwork Orange. Die Bücherwand verrät, wie sehr Michael Wollny für Sir Arthur Conan Doyle und Dracula schwärmt. Horrormärchen, Schauerfilme… Diese Leidenschaft begleitet den 28-jährigen Pianisten schon seit der Jugendzeit.
Sein Hexentanz bleibt musikalisch nah am Thema, er spielt mit den gängigen Genre-Klischees, fällt aber nicht auf sie hinein. Verminderte Akkorde schaffen eine düstere Grundstimmung, Pausen markieren Spannungsbögen, elektronische Effekte suggerieren gediegene Entrücktheit, rhythmische Attacken unterlaufen von tief unten das Geplänkel an der Oberfläche.
Die Klavierimprovisationen sind von dem Pianisten Joachim Kühn beeinflusst. Seine Methode des Diminished Augmented System wandte Wollny beim Titelstück an. Kühn geht in seinem Spiel von Klängen aus, nicht von Akkorden.
Im Jahr 2005 hatte Wollny das außergewöhnliche Trio-Album call it [em] mit Eva Kruse und Eric Schaefer herausgebracht. Certain Beauty, seine Duo-CD mit dem Saxofonisten Heinz Sauer, wurde in Frankreich als eine der besten CDs des vergangenen Jahres gefeiert. Nach den beiden intensivsten Jahren seiner Karriere zog er sich für ein paar Wochen in den hohen Norden zurück, um die Musik für Hexentanz zu komponieren.
Auf dem Album hat er auch drei Stücke von Björk neu interpretiert. Er bekennt, ein Anhänger der isländischen Sängerin zu sein, besonders ihre letzte CD Medúlla habe ihn sehr inspiriert. Ihn reizen Stücke wie ihr Anchor Song und Jóga, die Klassiker des Jazz spielt er kaum. Die Musik soll etwas mit seinem Leben zu tun haben und nicht schon von den Kollegen abgegrast worden sein. Wenn Wollny sich mit seinem Trio trifft, bringt er Musik mit, die er gerade hört. In jüngster Zeit waren das vor allem alte Sachen von Pulp und neue von Jarvis Cocker.
„Piano Works VII: Hexentanz“ von Michael Wollny ist als CD erschienen bei ACT
Weitere Beiträge aus der Kategorie JAZZ
Gil Evans: „The Complete Pacific Jazz Sessions“ (Blue Note 2006)
Sonny Rollins: „Sonny, Please“ (Doxy 2007)
Schlippenbach Trio: „Winterreise“ (Psi Records 2006)
Grant Green: „Live At Club Mozambique“ (Blue Note 2006)
OOIOO: „Taiga“ (Thrill Jockey 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik