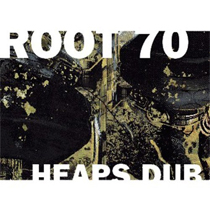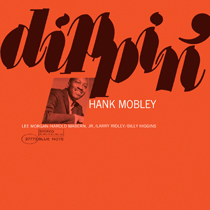Der Bassist William Parker ragt heraus aus der New Yorker Szene schwarzer improvisierender Musiker. Einer seiner ungewöhnlichen Ausflüge hat „Long Hidden – The Olmec Series“ gezeitigt: Merengue trifft auf radikalen Free Jazz
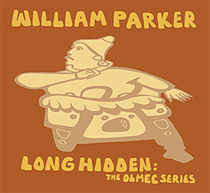
„The Revolution Continues“ stand in diesem Jahr auf dem Festival-T-Shirt. Zehn Meter lang waren die zusammengestellten Tische, auf denen CDs angeboten wurden, die sonst nur schwer erhältlich sind – meist veröffentlicht von kleinen Plattenfirmen mit Büros in Wohnungen und einer Internet-Adresse. Auf der Empore gab es „William Parker’s Fried Chicken“, schräg gegenüber lag seine neue CD Long Hidden: The Olmec Series zum Verkauf. Zum elften Mal leitete der Bassist das Vision Festival in New York, andernfalls hätte er seinen Namen wohl kaum einer Hähnchenkeule geliehen.
Wie schon immer in der Geschichte des Festivals geht es auch dieses Mal um Mieten für Spielorte und Gagen für improvisierende Musiker – Kostbarkeiten in einer konsumorientierten Welt, die leider niemand zahlen will. Parker fordert das politische Engagement seiner künstlerisch tätigen Kollegen ein, „Parker predigt den Gospel“, heißt es.
Er hat sein neues Album den Olmec, den Ureinwohnern Mittelamerikas, und ihrer Verbindung mit Westafrika gewidmet. Im Zentrum stehen Kompositionen für ein Ensemble aus drei erfahrenen Free Jazz-Musikern und vier sehr jungen Merengue-Spielern. In dem Stück El Puente Sec spielt Parker Perkussion und eine sechssaitige Dosen-Ngoni, die traditionelle Jägergitarre aus Mali. Sein Bass-Solo in Compassion Seizes Bed-Stuy korrespondiert mit dem Parker-Klassiker In Order To Survive und seiner Lebenserfahrung während der Bush-Ära – das ganze Stück hindurch sei ein Aufschrei spürbar, schreibt er: „Lord have mercy, fill these young black men with your spirit, before they fill another prison with young black men.“
Zu jedem Stück hatte Parker eine Geschichte, die er den Musikern bei den Proben erzählte. Von den Olmecs erfuhr er zum ersten Mal während seiner Afrika-Studien Ende der 60er, in seiner Komposition Pok-a-Tok wolle er zum Ausdruck bringen, dass sie große kreative Denker waren, „den Jazzerfindern Thelonious Monk, Bud Powell und Charlie Parker durchaus vergleichbar“.
Die Musik auf der CD bewahrt trotz unterschiedlicher und teils ungewöhnlicher Instrumentierung immer ihren ganz eigenen experimentellen Charakter. Wie ihm das gelingt, ist Parkers Geheimnis. Das gibt er auch nicht preis, wenn er erklärt, in der gestrichenen Bassimprovisation Cathedral of Light käme seine gesamte Musiktheorie auf den Punkt: „Sound ist Licht, und Licht ist Sound.“ Long Hidden: The Olmec Series, das sind intime Töne eines Revolutionärs, der mit jedem Song Heilung verspricht.
„Long Hidden – The Olmec Series“ von William Parker ist als CD erschienen bei AUM
Hören Sie hier ![]() „El Puento Seco“
„El Puento Seco“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie JAZZ
Soweto Kinch: „Conversations With The Unseen“ (Dune 2003)
Herbie Hancock: „Sextant“ (Columbia 1973)
Diverse: „The House That Trane Built“ (Impulse! 2006)
Kidd Jordan: „Palm Of Soul“ (AUM 2006)
Root 70: „Heaps Dub“ (Nonplace 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik