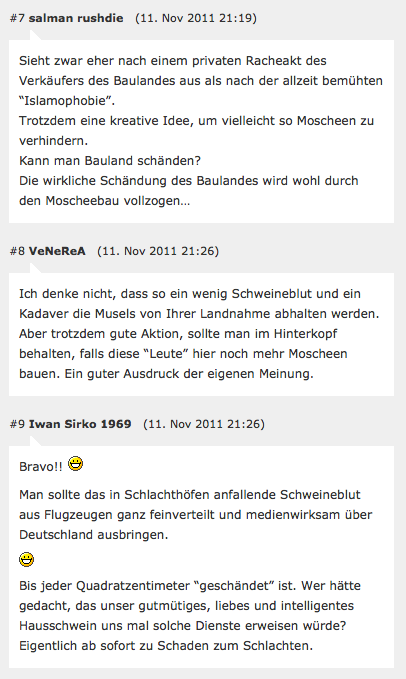Einige Begegnungen in einem Jahrzehnt der Angst und des Irrsinns.
Es kommt alles wieder hoch in diesen Tagen.
Am 11. September war ich in der Türkei im Urlaub. Im Supermarkt bemerkte ich, dass fremde Leute miteinander bedeutungsvoll tuschelten. Etwas war passiert, und das Entsetzen war groß. Die Türken fühlten sich mitgemeint und angegriffen von den Attentätern, es gab keinerlei Schadenfreude, niemand machte „den Westen“ selbst verantwortlich (wie es später manche westliche Intellektuelle taten). Es gab sogar die Hoffnung, dass die Westler nun besser verstehen würden, mit wem man es zu tun hatte bei den radikalen Islamisten. Dass sich hier ein Konflikt anbahnen würde, den manche bald schon im Muster eines Zivilisationskonflikts zwischen dem Islam und dem Westen sehen würden – das schien in den ersten Tagen in der Türkei undenkbar.
***
Ein paar Wochen später war ich für eine Woche im Iran, in Teheran und Isfahan. Ich hatte lange verabredet, mit einem deutschen Künstler das Land zu bereisen, der dort die erste westliche Ausstellung seit der Revolution zeigen durfte, und zwar im Teheraner Museum für moderne Kunst, einer Errungenschaft der Schah-Zeit. Als ich in der Nacht des Sonntags, des 7. Oktober 2001, am Teheraner Flughafen in ein Taxi stieg, begrüßte mich der Fahrer mit den Worten: Sie haben gerade begonnen, Afghanistan zu bombardieren.
Es herrschte gefasste Ruhe in Teheran, viel mehr als im aufgeregten Berlin, wo gegen den Krieg demonstriert wurde. Die Chatami-Regierung hatte die Hoffnung, durch den Anti-Terror-Krieg aus der Isolation zu kommen. Das zerschlug sich schnell, als auch die vom Iran gesponserte Hisbollah auf die Liste der Organisationen geriet, die im Global War on Terror isoliert und besiegt werden sollten. Die Iraner sahen mit einer Genugtuung, die mich überraschte, die Vernichtung der Taliban kommen. „Wir hätten es irgendwann selber tun müssen„, sagte ein Teheraner zu meinem Erstaunen. „Wir leiden indirekt unter deren Regime, sehen Sie nur all die Flüchtlinge aus Afghanistan hier im Land – und all die Drogen, die hier eingeschmuggelt werden und die Jugend kaputt machen.„
Damals schien es nicht denkbar, dass die Sache dazu führen würde, dass Iran einerseits viel mächtiger werden würde durch Amerikas Kriege, andererseits aber zu einem isolierten Paria-Staat wie später unter Ahmadineschad mit seinem Israel-Hass. Eine Frau in Teheran schockte mich mit diesem Kommentar zum Krieg in Afghanistan: „Ja, diese verdammten afghanischen Bauern sind amerikanische Bomben wert, aber für uns Iraner tut ihr nichts.“
***
Als ich aus dem Iran zurückgekehrt war, fragte mich unser Büroleiter Gunter Hofmann, der über sehr gute Verbindungen ins Schröder’sche Kanzleramt verfügte, ob ich mir vorstellen könnte, mal zu einer informellen Gesprächsrunde dorthin zu gehen. Es gehe um eine Art Brainstorming über das Thema des islamistischen Terrors, und schließlich hätte ich ja gerade auch Anschauung aus dem Iran und könnte vielleicht Interessantes über die Debatte dort beitragen. Ich sagte zu, wenn auch mit mulmigem Gefühl, war ich doch kein Experte. Ich stellte mir vor, dass da wahrscheinlich eine Reihe anderer Kollegen anwesend sein würden, die ebenfalls mehr Experten für die deutsche Öffentlichkeit als für den islamistischen Terror wären. Was sollte schon sein? Es wäre interessant zu sehen, wie das Kanzleramt nur Wochen nach den Anschlägen so tickte.
Steinmeiers Büroleiter Stephan Steinlein rief mich an, ob ich mal am Sonntagmorgen ins Kanzleramt kommen könnte – und übrigens, wen könnte man denn noch zum Thema Islamismus einladen?
Die Frage ließ mich stutzen, ich empfahl für den deutschen Kontext Werner Schiffauer wegen seiner Feldstudien über den „Kalifatstaat“ und Milli Görüs. Aha, interessant, bis Sonntag dann.
Sonntagmorgen im Kanzleramt wartete ich mit Professor Schiffauer darauf, dass man uns nach oben bringen würde. Außer uns war niemand da. Die anderen seien wohl sicher alle schon drinnen, vermuteten wir. Steinlein kam und führte uns in die oberste Etage, allerdings nicht in einen der üblichen Besprechungsräume, sondern in einen Bereich voller Beamter der Sicherheitsdienste. Ein U-förmiger Tisch war gedeckt, ihm gegenüber zwei Plätze, auf die Schiffauer und ich verwiesen wurden. Dann traten einige Herren aus einem anderen Raum hinzu, und mir wurde nun sehr mulmig: BND-Chef August Hanning, Geheimdienstkoordinator Ernst Uhrlau, Verfassungsschutz-Chef Heinz Fromm und der Uwe-Karsten Heye, Schröders Sprecher, grüßten und setzten sich. Man warte noch auf Kanzleramtschef Steinmeier, dann könne das Hearing losgehen. Und da wurde mir klar: Es gab keine Kollegen, das hier war keine Hintergrundplauderrunde, es war ein Expertenhearing, und die Experten waren: Professor Schiffauer und ich. Zu dieser Zeit tagte regelmäßig die „Sicherheitslage“ der versammelten Dienste im Kanzleramt, weil man auch in Deutschland täglich mit Anschlägen rechnete.
Das hatten die Herren gerade hinter sich gebracht, nun sollte beim Lunch Experten-Input geliefert werden. Es kamen sehr gezielte Fragen zur radikal-islamischen Szene in Deutschland. Vor allem Steinmeier war sehr gut vorbereitet, wollte zum Beispiel wissen, wie sich die türkischen Islamisten von den arabischen Netzwerken unterscheiden, wo sie zusammenarbeiteten, wie militant sie jeweils seien, wo die ideologischen Unterschiede lägen etc. Hinter ihm an der Wand hing eine Karte Afghanistans mit zahlreichen Markierungen und Fähnchen drin.
Ich war dann doch recht froh, Professor Schiffauer an meiner Seite zu haben! Dennoch bin ich tausend Tode gestorben. Meine Eindrücke aus dem Iran konterte Hanning mit Sätzen, die so begannen: „Unser Mann in Isfahan berichtet aber, dass beim Freitagsgebet…“
Fromm saß die ganze Zeit mit mürrischem Blick dabei, rauchte eine nach der anderen und sagte nichts. Der hat dich durchschaut, dachte ich, der weiß, was das hier für ein Hochseilakt ist, der langweilt sich. Dann meldete er sich zu Wort: „Ich will jetzt mal bitte eines von den Herren wissen – sollen wir Milli Görüs weiter unter Druck setzen und verbieten oder nicht?“ Ich ließ Schiffauer den Vortritt. Er war für eine eher kooperative Linie, weil er die Gruppe nicht für gefährlich hielt. Ich plädierte für ein hartes Engagement, die Gruppe müsse sich nun entscheiden und klar von den politischen Zielen des Islamismus lossagen. Es wurde eine recht muntere Debatte, und ich habe nachher nie Klagen gehört. Aber als ich das Kanzleramt verließ, hatte ich ein taubes Gefühl, so wie ein Fußgänger, der beim Überschreiten der Straße knapp einem Lastwagen entgangen ist, der ihn nur um Zentimeter verfehlt hat.
Kann es sein, dass die im Kanzleramt so absolut keine Ahnung hatten, wen sie fragen sollten bei dem Thema? Dass die von selber nicht einmal auf den Professor Schiffauer gekommen wären?
Es war wohl damals so. Die Politik war ganz und gar geschockt und überrascht von dem Thema, und ich war mitten hinein geraten in einen der Orientierungsversuche. Immerhin, Schaden habe ich offenbar nicht angerichtet.
Das war mein kurzes Leben als Kanzlerberater.
Später hat das Kanzleramt einen eigenen Experten eingestellt, einen erstklassigen Kenner Saudi-Arabiens und des Al-Qaida-Terrorismus. Ich bin bis heute dankbar für den Einblick dieses Sonntagmorgens, und ich würde ihn allen Verschwörungstheoretikern gerne gönnen.
***
Ende 2003 besuchte ich einige amerikanische Intellektuelle, um über die US-Debatte zum bevorstehenden Irakkrieg zu berichten. Mark Lilla, ein konservativer Kriegsskeptiker, den ich aus seinen Berliner Tagen kannte, machte mich auf seinen Freund Paul Berman aufmerksam, einen der führenden „linken Falken“. Paul verteidigte Bush gegen seine linken Freunde („Bush is not the enemy“) und er hatte gerade ein Buch geschrieben, in dem er erklärte, warum die Linke den Kampf gegen den Terrorismus der al-Qaida unterstützen musste – und warum sich hinter diesem Konflikt noch ein viel größerer verbarg.
Er leitete den neuen Totalitarismus der islamistischen Gefahr aus eindringlichen Analysen der Schriften von Sayid Qutb her, dem intellektuellen Vater der Muslimbruderschaft – und aus der Geschichte der Baath-Partei mit ihrem national-sozialistischen Programm zur Befreiung der Araber. Die Fusion dieser beiden Strömungen war in Pauls Sicht in Saddam Husseins Irak gegeben – Baathismus und Islamismus vereint im Kampf gegen den Westen. Gab es nicht Beweise für die Zusammenarbeit von Saddam und al-Qaida? Und selbst wenn nicht, stellten beide doch eine tödliche, islamofaschistische Gefahr dar, so schlimm wie im Kalten Krieg der Sowjetkommunismus.
Paul konnte den Beweis für diese Gefahr aus seinem Fenster in Brooklyn sehen, in Gestalt der Lücke, wo einst die Türme gewesen waren. Er war am 11. 9. zum Augenzeugen der Zerstörung des World Trade Center geworden. Wir trafen uns in einer Sushi-Bar in Manhattan und haben uns sofort gut verstanden. Paul erzählte von seinen kommunistischen Vorfahren, jüdische Einwanderer aus Russland, von seinem eigenen früheren Trotzkismus, von seiner allmählichen Gegnerschaft zur loony left, zur verzweifelten Michael-Moore-Linken. Ein linker, liberaler, anti-totalitärer Bush-Verächter und Kriegsbefürworter: Ich war begeistert. Auf dem Rückflug aus New York las ich sein druckfrisches Buch, das auch mich für den Irak-Krieg einnahm.
***
Ich begann, mich für die irakische Diaspora zu interessieren. Ich las Kanan Makiyas Buch über Saddams Irak, Republic of Fear. Es schien Paul Bermans Sich zu bestätigen. Ich nahm zu Makiya Kontakt auf, der damals an der Brandeis University lehrte. Wir machten ein Interview über den geplanten Krieg, in dem ich kritische Fragen stellte, während er die Gründe für eine Intervention stark machte.
Er erwischte mich kalt mit dem Punkt, dass auch die Deutschen durch eine Invasion mit anschließendem nationbuilding in die Welt der zivilisierten Völker zurückgeholt worden waren. Ich fühlte mich mit meinen Bedenken gegenüber der Modernetauglichkeit der Iraker ein wenig rassistisch. Heute erscheint mir dieses Argument ein ziemlich billiger Trick.
Kanan Makiya ging später nach Bagdad zurück, nachdem die schlimmsten Zustände nach der Invasion dort vorbei waren. Doch nach den Plünderungen kamen die ethnischen Säuberungen und der religiöse Bürgerkrieg. Es wurde die Enttäuschung seines Lebens für den säkularen Schiiten aus der irakischen Elite. Dass diese Gesellschaft so kaputt war, hatte er aus seinem Exil nicht sehen wollen – oder können.
Er war in einer Gruppe tätig gewesen, die für das State Department an Nachkriegsplänen gearbeitet hatte. Er schickte mir Materialien aus diesen Sessions, damit ich einen Artikel darüber schreiben könnte. Ich habe das nicht getan, weil anderen Redakteuren mulmig dabei zumute war, dass man hier möglicher Weise einer Propagandainitiative der Bushies aufsitzen würde.
Heute bin ich froh darüber, denn bald erzählte mir Kanan Makiya, dass die ganze Arbeit dieser Gruppe für die Katz war, weil das Pentagon nichts von nationbuilding hören wollte. Es passte einfach nicht zu Rumsfelds Idee von einem „schlanken Krieg“ aus der Luft.
Kanan ist eine tragische Figur, wie so viele Exilanten, die davon träumen, ihr Land zurück zu bekommen und dann feststellen müssen, dass es dieses Land gar nicht mehr gibt. Man nimmt den bösen Führer weg, und zum Vorschein kommt eine zerstörte Gesellschaft. Das werden wir auch hier und da in den arabischen Revolutionen sicher wieder erleben, wenn auch – hoffentlich – nicht so extrem wie im Irak.
***
Ende 2004 wurde ich von Jeffrey Gedmin, dem Direktor des Aspen-Institus in Berlin, zu einer Tagung über Iran auf einen Landsitz nahe Avignon eingeladen. Ich kam mit Jeffrey gut klar, weil ich damals die Positionen der „linken Falken“ teilte, die den Krieg im Irak unterstützten. Der wohl vernetzte Neocon Gedmin sah meinesgleichen wahrscheinlich als nützliche Idioten der Bush-Politik. Und er hatte nicht ganz unrecht damit. Gedmin hatte einige seiner Washingtoner Freunde nach Frankreich eingeflogen, zum Beispiel den EX-CIA- Mann Reuel Gerecht, einen Iran-Experten, der zuverlässig für einen harten Kurs gegenüber Teheran stand. Und harter Kurs, das hieß nun Krieg.
Stargast des Tages war John Bolton, der damals Staatssekretär für Rüstungskontrolle war. Er wurde eigens mit dem Hubschrauber eingeflogen. Schnell wurde mit deutlich, dass hier gar nicht mehr über die eventuelle Notwendigkeit eines Krieges gegen den Iran debattiert werden sollte. Es ging eigentlich nur noch darum, die Europäer an den ohnehin geplanten Krieg heranzuführen. Ich war einigermaßen geschockt zu bemerken, dass unsere Freunde schon fest entschlossen waren, nach dem Irak nun das nächste Glied der Achse des Bösen zu bombardieren. Nackter Irrsinn. Eine Hybris, die man durch keine Einwände mehr erreichen konnte. Zweifel wurden weggewischt. Einwände, die Machbarkeit betreffend – mit zwei bereits laufenden Kriegen in Afghanistan und Irak, und jeweils unmenschlichen Aufgaben, was das nationbuilding betraf – wurden schnöde abgewiesen durch Kommentare wie: „We have lots of planes to bomb them to hell.“ (Reuel Gerecht) Auf die erschrockene Frage meiner Frau, die für die Welt an dem Treffen teilnahm, wie man denn zugleich einen neuen Krieg nebst Stabilisierung in Afghanistan und Wiederaufbau im Irak bewältigen wolle, sagte Bolton: „We don’t do nationbuilding. It was a mistake to start it in the first place.„
Was hätte man denn sonst im Irak machen sollen? Bolton: „You go in. You hit them hard. You leave. And then it’s: Good bye and Good luck with your country!“
Wir verließen Avignon mit dem Gefühl einer drohenden Katastrophe. Und so ist es dann ja auch gekommen. Im Jahr darauf ging der Aufstand im Irak los. Iran hatte sich damit als Ziel vorerst erledigt. Alle Energie wurde nun für den Surge gebraucht. Tausende amerikanischer Soldaten haben mit dem Leben dafür bezahlt, und sicher auch Zehntausende Iraker.
***
Im August 2006 traf ich Hazem Saghieh in London zum Interview. Er verantwortete damals die Meinungsseiten bei der liberalen panarabischen Tageszeitung Al Hayat und galt als einer der führenden arabischen Liberalen. Hazem war ein ursprünglich libanesischer Linker, der mit Entsetzen seit den Siebzigern den Aufstieg des Fundamentalismus in der arabischen Welt beobachtet hatte – und zugleich einer der schärfsten Kritiker von Autokraten wie Saddam Hussein oder Assad, die sich die Wut der arabischen Straße zunutze gemacht hatten.
Ich traf ihn kurz nachdem in London Pläne für große Attentate aufgedeckt worden waren, und wir sprachen über die ohnmächtige Wut der arabischen Jugend.
Hazem erzählte mir, dass er vor dem Irakkrieg zu einem Expertenhearing in einem regierungsnahen Thinktank eingeladen worden war. Man wollte dort über den Irakkrieg reden und sondieren, wie er wohl in der arabischen Welt aufgenommen werden würde.
Hazem warnte vor dem Krieg, obwohl seine Ablehnung von Saddams Terrorherrschaft außer Frage stand. Die Amerikaner, sagte er mir, erklärten sich damals die Lage in den arabischen Ländern analog zu der in Osteuropa im Kalten Krieg. Sie dachten, sie mussten nur die böse Herrschaft der Diktatoren loswerden, damit die gute, unterdrückte Gesellschaft sich endlich frei und demokratisch entfalten könnte.
„Aber so läuft es in unseren Gesellschaften in Nahen Osten nicht. Es gibt keine Zivilgesellschaft im Irak, die an die Stelle des bösen Herrschers treten kann. Osteuropa war lange während des Kalten Krieges in einer Art unglücklicher Liebe dem Westen und seinen Idealen verbunden. Bei uns ist das nicht so. Wir werden von der Tyrannei in den Bürgerkrieg übergehen.“
„Die haben mir zugehört da in Washington„, sagte Hazem, „höflich, aber ein wenig peinlich berührt. Ich wurde nie wieder eingeladen.“
Heute frage ich mich manchmal, was Hazem wohl über Tunesien, Ägypten und Libyen denkt, wo es nicht so finster zu kommen scheint, wie er zu Recht für den Irak befürchtet hatte.
Aber dort sind es ja auch Kräfte von innen, die die Tyrannen stürzen, wenn auch in Libyen mit äußerer Hilfe.
Was wohl Hazem zu alledem denkt? Er ist vor Jahren aus London zurück nach Beirut gegangen. Ich muss ihn mal wieder anrufen.