In der Finanzpresse wird gerade das fünfjährige Jubiläum der Pleite von Lehman Brothers begangen. Sie gilt als der Beginn der Finanzkrise, in der die OECD-Länder immer noch stecken. Ich würde den Beginn allerdings eher auf den Sommer 2007 datieren, als der amerikanische Hypothekenmarkt zusammenbrach, der europäische Geldmarkt auf einmal illiquide wurde und die Düsseldorfer IKB gerettet werden musste. Die Banken hatten sich damals plötzlich nicht mehr gegenseitig über den Weg getraut, weil sie den Verdacht hatten, dass sich viele von ihnen mit amerikanischen (asset backed) „Wertpapieren“ verzockt hatten – was sich ja bald als zutreffend erwies. Im Sommer und Herbst des Jahres 2007 begann sowohl in den reichen Ländern als auch in den wichtigsten Schwellenländern ein starker Rückgang der Aktienkurse und – wenn auch nur in den Ländern mit guter Bonität – ein scharfer Rückgang der Anleiherenditen.
Wie auch immer, jetzt sind fünf oder sechs Jahre ins Land gegangen, aber die Arbeitslosenzahlen sind immer noch nicht richtig gesunken (Deutschland ist eine erfreuliche Ausnahme), überall gibt es große Kapazitätsreserven, die Inflationsraten liegen deutlich unterhalb ihrer Zielwerte und die Zentralbanken versuchen durch Gelddrucken und mit Leitzinsen von fast null Prozent Haushalte und Unternehmen dazu zu bewegen, doch bitte endlich wieder mehr Schulden zu machen, Geld auszugeben und so die Konjunktur in Schwung zu bringen. Das gelingt nicht so richtig. Andererseits ist es wohl normal, dass sich Rezessionen lange hinziehen, wenn sie durch das Platzen von kreditfinanzierten Aktien- und Immobilienblasen wesentlich mitverursacht worden sind, siehe Japan. Es braucht seine Zeit, bis Haushalte, Banken und Staaten ihre Finanzen wieder in Ordnung gebracht haben – Schuldenabbau verträgt sich nicht mit einer starken Expansion der Nachfrage.
Keineswegs normal ist aber, dass es den Politikern und den Aufsehern nicht gelungen ist, das Finanzsystem, das uns die Probleme eingebrockt hat, so zu stabilisieren, dass ähnliche Krisen nicht noch einmal passieren können. Zwar sind einige Exzesse inzwischen beseitigt worden, die Banken sind besser kapitalisiert und ich vermute, dass die Banker zumindest für eine Weile nicht mehr so leichtfertig Kredite vergeben. Allerdings gibt es nach wie vor Entwicklungen und Strukturmerkmale im Banken- und Finanzsektor, die das System destabilisieren können. Gillian Tett hat kürzlich in der Financial Times sechs Tendenzen aufgelistet, die genau in die falsche Richtung gehen.
1. Die großen Banken sind größer als vor der Krise. Mehr als zuvor können sie sich darauf verlassen, dass sie nicht in Konkurs gehen werden. Sie sind „too big to fail“. Lehman Brothers wird es nicht mehr geben. Im Grunde ist das eine Einladung an die neuen Giganten, große Risiken einzugehen – die Steuerzahler werden sie schon raushauen.
2. Laut Financial Stability Board (FSB) ist das weitgehend unkontrollierte System der Schattenbanken inzwischen auf ein Volumen von 67 Billionen Dollar gewachsen, oder um 13,5 Prozent gegenüber 2008. Der Trend wird sich vermutlich fortsetzen, weil Banken bestimmte Aktivitäten nicht mehr erlaubt sind, auch wenn das FSB betont, dass die Geschäfte der Banken mit Hedge- und Private Equity-Funds genauer überwacht würden. Wer’s glaubt!
3. Die Anleger sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass die Zentralbanken wissen was sie tun. Da vertun sie sich vermutlich: Es hat so etwas wie das „quantitative easing“ oder eine jahrelange Nullzinspolitik noch nie gegeben. Wo soll die Erfahrung herkommen? Auch die Notenbanken wissen nicht, wann und wie sich die Leitzinsen „normalisieren“ lassen, oder um wie viel und über welchen Zeitraum hinweg sie das Gelddrucken per „quantitative easing“ zurückfahren sollten, und wie das auf die Realwirtschaft wirkt. Die Anleger stellen die gesamtwirtschaftliche Schlüsselrolle der Fed oder der EZB zu wenig infrage. Die Notenbanken haben kein viel besseres Verständnis der ökonomischen Wirkungszusammenhänge als sie selbst. Sie haben es schließlich sehenden Auges zu gefährlichen Blasen bei den Vermögenspreisen kommen lassen.
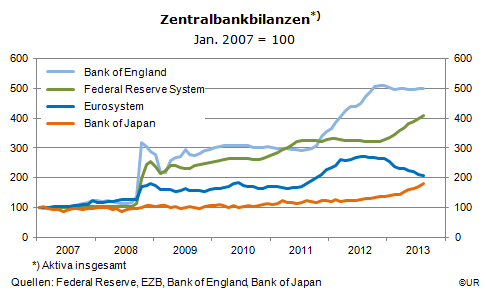
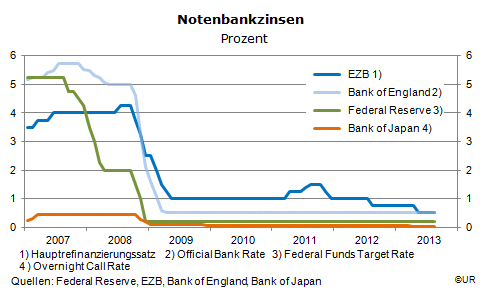
4. Die Reichen sind immer reicher geworden. Obwohl die Menschen fast überall wütend sind über die sehr ungleiche Einkommensverteilung (Tea Party, Occupy Wall Street), ist sie in den letzten Jahren noch ungleicher geworden. Ein Nebeneffekt der expansiven Geldpolitik besteht darin, dass die Vermögenspreise, also die Aktienkurse und Immobilienpreise, tendenziell steigen. Vor allem die kleine Gruppe der Aktienbesitzer hat davon profitiert. Die Aktienindices sind in den USA und Deutschland trotz der schlechten Konjunktur heute deutlich höher als vor der Krise.
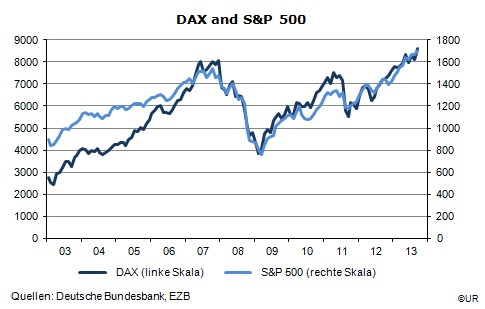
5. Es hat praktisch keine strafrechtliche Verfolgung derjenigen Financiers gegeben, die für die Verschuldungsblase verantwortlich waren. Auch die Rating-Agenturen sind ziemlich ungeschoren davongekommen. Nach der amerikanischen Savings&Loan-Krise der frühen neunziger Jahre waren nicht weniger als 2000 Banker rechtswirksam verurteilt worden.
6. Die inzwischen voll verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie und Freddie Mac sind noch größer als vor Ausbruch der Finanzkrise, für den sie ein gerüttelt Maß an Verantwortung tragen, einschließlich des Lehman-Konkurses. Sie kontrollieren heute 90 Prozent des Hypothekenmarkts, verglichen mit 60 Prozent vor der Krise. Und sie stimulieren mit verbilligten Krediten den Wohnungsbau. Ich habe gerade nachgesehen: Von Anfang 2011 bis vergangenen Juli ist die Anzahl der Baugenehmigungen um nicht weniger als 74 Prozent gestiegen – das Niveau ist nach wie vor niedrig, aber es geht schon fast wieder so rund wie vor der Krise; die amerikanischen Immobilienpreise wiederum haben seit ihrem Tiefpunkt im März 2012 um 19 Prozent zugelegt („Case-Shiller-Index“) und bewegen in Richtung ihrer früheren Höchststände. Es sieht so aus, als sollten die alten Verhältnisse wieder hergestellt werden!
Gillian Tett kommt zu dem Schluss, dass keines dieser sechs strukturellen Probleme gelöst sei. Ich kann mich dem nur anschließen, finde aber, dass es auf mindestens zwei weiteren Feldern noch dringend Reformbedarf gibt:
7. Die Boni der Banker müssen unbedingt begrenzt werden. Es darf keinen Anreiz geben, große Risiken einzugehen und dadurch reich zu werden, wenn es nicht gleichzeitig bedeutende finanzielle oder strafrechtliche Sanktionen gibt, wenn die Sache nicht aufgeht.
8. Nach wie vor ist die Eigenkapitalausstattung der Banken – auch die neuerdings angestrebte höhere – viel zu gering; dadurch sind sie sehr anfällig bei einem scharfen Anstieg der Leitzinsen oder einer plötzlichen tiefen Rezession, etwa im Gefolge eines Ölschocks. Das wiederum begrenzt den Bewegungsspielraum der Zentralbanken: Sie können unter Umständen nicht so wie möchten. Die niedrigen Eigenkapitalquoten stellen im Übrigen eine Subvention des Bankensektors dar. Die im Vergleich zur normalen Industrie aberwitzigen Renditen auf das Eigenkapital sind nur deshalb möglich, weil ihnen die Aufseher erlauben, mit extrem viel Fremdkapital zu operieren. Es wäre viel gewonnen, wenn den Banken in dieser Hinsicht ihr Sonderstatus genommen würde (ich bin darauf näher in meiner Besprechung des Buches von Admati und Hellwig: „The bankers‘ New Clothes“ eingegangen).
Das Problembewusstsein ist bei den Politikern vermutlich vorhanden, und auch in der Öffentlichkeit herrscht der Eindruck vor, dass die Banken an die Leine gelegt werden müssten. Auf eine intensive öffentliche Diskussion warte ich aber bislang vergeblich.