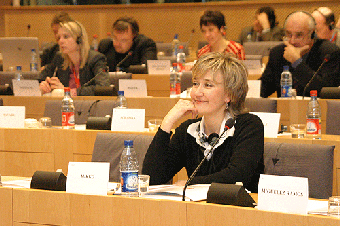Am 7. Juni sind Europawahlen.
Doch was für ein seltsames Wesen ist eigentlich die Brüsseler Volksvertretung?
Eine Erkundung

Brüssel / Straßburg
„Ja!“, schreit Daniel Cohn-Bendit. „Politik! Echte Politik!“ Er springt aus seinem Sessel auf. „Genau! Das braucht Europa!“ Wie aufgeputscht geht der Fraktionsvorsitzende der Grünen in seinem Abgeordnetenbüro auf und ab. Der Blick hinaus streift die hochhausartige Spiegelfassade des Europäischen Parlaments. Rechts im Tal darunter erstrecken sich die profanen Schindeldächer Brüssels. Auf dem Fensterbrett vor dem Alt-Revolutionär Cohn-Bendit liegen zwei Pflastersteine. Relikte aus einer Zeit, als Politik noch greifbar war. Als Meinungsstreit noch Richtungsstreit war und Ideen Straßen aufheizten.
Das andere Ende der Intensitätsskala heißt Europaparlament. Es ist ein Organ, von dessen Natur und Funktion kaum ein Bürger eine Vorstellung hat. Im gefühlten politischen Bewusstsein changiert es zwischen geheimnisvoller Hypermacht und zweitklassig bestückter Folkloretruppe. Vielleicht scherten sich deswegen bei der letzten Wahl 2004 nur 47,5 Prozent der Europäer die Bestellung ihrer Abgeordneten. Vielleicht sagen auch deswegen heute 51 Prozent der 375 Millionen wahlberechtigten EU-Einwohner, sie interessierten sich nicht für die nächsten Europawahlen am 7. Juni.
Ist das dumpfe Gefühl, dass es sich beim Europaparlament bloß um eine Simulation von Politik handelt, womöglich richtig – und das niedrige Bürgerinteresse mithin berechtigt? Oder scheitern an dem, was dieses Gebilde in Wirklichkeit ist, die gewohnten Kategorien von Politik – mit der Folge, dass die Wählerhirne das Europaparlament zu Unrecht übersehen?
Daniel Cohn-Bendit greift sein Jackett, bedenkt die drei Mitarbeiterinnen in seinem Vorzimmer mit ausgiebigen Bussis und tritt hinaus in die Parlamentsflure. Es ist ein Labyrinth, das jeden Neuling das Kafkaeske dieses Apparates spüren lässt. Die Büros der 785 Abgeordneten aus 27 Ländern tragen Postleitzahlen wie ASP 7G 351 und sind so eng, dass man aufpassen muss, keine Bilderrahmen von der Wand zu fegen, wenn man sich in ihnen herumdreht. Im Foyer sortieren Assistenten Dokumente in riesige, tausendfächrige Regalablagen. Noch der kleinste Änderungsantrag muss ins Gälische oder Maltesische übersetzt werden muss, bevor ein Rädchen sich weiterdreht.

Cohn-Bendit findet blind seinen Weg durch das Gewirr der Gänge, im Gehen tippt er Kurzmitteilungen an die Fraktionsmitglieder in sein Handy. „Ja, sicher!“, ruft er wieder und wedelt mit der sommerbesprossten Hand, „wir müssen die Auseinandersetzung hier politisieren!“ Dann redet er von Klimaschutz, von neuen Bankenregeln, von einer anderen Afghanistanpolitik, von einem sozialeren Europa. Doch für mindestens die Hälfte all dieser Angelegenheiten haben er und seine Kollegen überhaupt kein Mandat.
Das Europaparlament besitzt kein Initiativrecht für Gesetzgebung. Es kann lediglich mitentscheiden über Vorhaben der EU-Kommission, die im weitesten Sinne den Binnenmarkt betreffen. Die Folgen dieser Richtlinien spüren zwar sämtliche Europäer jeden Tag. Etwa dann, wenn Flug- oder Telefonkosten sinken, wenn plötzlich biometrische Pässe ausgegeben werden, wenn die Glühbirne verboten wird oder neue, CO2-sparende Autos auf den Markt kommen. Doch um unliebsame Ideen der Brüsseler Kommission zu kippen, muss das Parlament eine absolute Mehrheit aufbringen. In der Praxis führt das zu einer permanenten Großen Koalition zwischen den beiden großen Fraktionen, der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) und den Sozialdemokraten (SPE). „Es gibt hier den institutionalisierten Zwang zum Kompromiss“, sagt ein EVP-Abgeordneter. Die Folge: „Man duzt sich“, auch politisch.
Im Falle von Daniel Cohn-Bendit wirkt diese Grundharmonie regelrecht tragisch. Im riesigen Hémicycle, dem zweitgrößten Plenum nach der indischen Volksversammlung, sieht man den Grünen-Chef versunken in der taz-Lektüre, während um ihn herum das Händegepaddel der Abstimmungen die Saalluft aufwühlt. Von der außerparlamentarischen Opposition hat ihn sein Weg in ein oppositionsloses Parlament geführt. „Dafür? – Dagegen? – Enthaltungen? – Angenommen“, schallt es in einer Endlosschleife vom Präsidiumspult.
Als „Corporate Identity“ beschreibt der deutsche Sozialdemokrat und EU-Veteran Jo Leinen die Stimmung, die im Haus oft herrsche. Anders als in den „Konkurrenzdemokratien“ der Landtage oder des Bundestages teilt sich das EP überdies nicht in Regierungsfraktion und Gegenlager auf, sondern steht vereint gegen 27 nationale Regierungen, denen – so sieht es Leinen – das große europäische Ganze oft immer noch nicht klar genug sei. Einen zusätzlichen Kitt bilde „der Schulterschluss gegen das Lager der Anti-Europäer“. Die mögen zwar in Wahrheit oft nur EU-Kritiker sein, aber solche Unterscheidungen stören nur das Kollektivbewusstsein.

Komplexe Materien, unbekannte Gesichter, statt Streit Stigmatisierung von Querdenkern – kein Wunder, dass Europapolitik verlangweilt, ja, dass sich beim Wähler der Eindruck breit macht, diese Volksvertretung sei recht eigentlich eine bessere NGO mit dem Vereinsziel europäische Integration.
„Die Abwesenheit von Politik gilt ja quasi als Errungenschaft dieses Parlaments“, sagt die Spitzenkandidatin der FDP, Silvana Koch-Mehrin (Foto). „Man muss sich schon entscheiden: Will man eine Harmonieveranstaltung sein oder ein streitbare Versammlung?“ Sie hat es sich angewöhnt, statt Brüsseler Abgeordneten lieber Berliner Minister für Entscheidungen anzugreifen, die sie bei EU-Treffen mittragen. Das, sagt sie, bringe daheim wenigstens Schlagzeilen.
Sahra Wagenknecht fühlt denselben Frust. Die (Noch-)Europaabgeordnete der Linken fremdelt mit der französischen Bedienung im Restaurant des Parlaments, als sie sich – eher widerwillig – ein überteuertes Fischgericht bestellt. Ihre Brüsselbilanz klingt, als ziehe sie Gräten aus der Erinnerung. „Im Bundestag haben wir als Linkspartei ja immerhin noch die Möglichkeit, Themen an die Öffentlichkeit zu ziehen und damit andere Parteien unter Druck zu setzen. Hier hingegen arbeitet man wie unter einer Glocke.“ Nach fünf Jahren verzieht sich Wagenknecht aus dem Teflonparlament – aufgefallen ist ihr Auslandsaufenthalt daheim in Berlin ohnehin kaum jemandem. „Die Leute auf der Straße gehen oft davon aus, ich sei im Bundestag.“
Und doch, es gibt Opposition im EU-Parlament. Allerdings richtet die sich regelmäßig nur gegen die Details von Harmonisierungsgesetzen, nicht auf die Frage, ob dieses oder jenes Harmonisierungsgesetz tatsächlich notwendig ist. Warum etwa muss die EU die Länge des Mutterschutzurlaubes vereinheitlichen? Warum muss sie sich mit der Untertitelung von Filmen beschäftigen? Warum in einem intransparenten Verfahren die Glühbirne verbieten?

Am 19. Februar 2009 öffnet, aus protokollarischem Zwang, das blaue Brüsseler Rund einem seiner schärfsten Kritiker die Tore. Der tschechische Präsident Vaclav Klaus darf anlässlich der EU-Präsidentschaft eine Rede im Europaparlament halten. Die Stimmung ist angespannt. Und Klaus enttäuscht nicht. „Sind Sie sicher“, provoziert der Tscheche, „dass Sie über Sachen entscheiden, die gerade hier in diesem Saal und nicht näher am Bürger entschieden werden müssen?“ Buh-Rufe fliegen ihm entgegen, aber auch vereinzelter Beifall. Dann jedoch sprengt Klaus die Schmerzgrenze.
„In unserem Teil Europas“, sagt er, „haben wir die bittere Erfahrung gemacht, dass dort, wo es keine Opposition gibt, die Freiheit verkommt.“ Mehrere Abgeordnete, unter ihnen auch der Deutsche Jo Leinen, verlassen daraufhin den Saal. Die Kränkung war zu existentiell. Und ein bisschen zu wahr wohl auch die Erinnerung daran, dass Menschen sich immer noch am liebsten regional und national, nicht supranational regieren lassen.
Eine Folge der eingeschränkten Initiativmacht des EP ist ein dauernder Energieüberschuss bei vielen seiner Mitglieder. Der führt zu zweierlei. Einerseits zu einer Flucht in NGO-hafte Awareness-Politik. Andererseits aber auch dazu, dass sich das Parlament zur Auxiliartruppe europäischer Außenpolitik erklärt.
An einem Herbsttag lädt die estnische Abgeordnete Marianne Mikko in den Pressesaal „Anna Politkowskaia“ ein (benannt nach der ermordeten russischen Enthüllungjournalistin). Sie möchte einen Erfolg feiern, denn gerade hat das Parlament mit 307 zu 262 Stimmen Mikkos Bericht über „Gemeinnützige Bürger- und Alternativmedien in Europa“ angenommen. Darin fordert die Sozialdemokratin eine „Diskussion“ darüber, welcher Rechte und Pflichten Blogger haben sollten. Denn, so mahnt sie: „Worte können töten“.
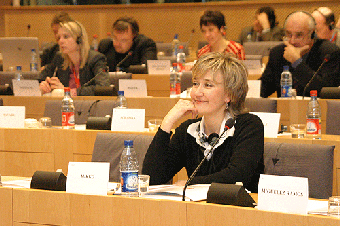
Aber, Frau Mikko, es gibt doch bereits Presse- und Strafrechtsregelungen. Wo also ist der Handlungsbedarf?
„Ich rufe“, antwortet sie etwas verdruckst, „dazu auf, dass Blogger wie menschliche Wesen handeln. Ich rufe zur Menschlichkeit auf!“
Mikkos Bericht wird von der EU-Kommission, wie zahllose andere Berichte und Resolutionen auch, betreffend etwa die Situation der Bären in China oder die Lage in Ostjerusalem, wohlwollend zu den Akten genommen werden.
Anderseits kann das EP durchaus schmerzhafte Tritte erteilen. Etwa dann, wenn nationale Einzeldiplomatie zu unentschieden erscheint. Es ist ein kalter Wintertag, und seit kurzem ist die russische Gaszufuhr Richtung EU abgeklemmt. In Rumänien frieren EU-Bürger. Im Sitzungssaal des Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments drängen sich die Journalisten, denn eine Politiker-Delegation aus der Ukraine hat sich eingefunden.
Verständnisheischend lächelt der stellvertretende Ministerpräsident aus Kiew in die Runde – und versucht erwartungsgemäß, die Schuld an dem Lieferengpass allein Russland zuzuschieben. Dem deutschen Ausschussmitglied Alexander Graf Lambsdorff (FDP) platzt daraufhin der Kragen. „Regelt das zwischen Euch!“, entfährt es ihm. „Wir wollen keine warmen Worte, wir wollen warme Wohnung. Also regelt das!“
Der Ukrainer ist sichtlich erschüttert. Es dürften die klarsten Worte gewesen sein, die er von seinem Europa-Tripp mit nach Hause nahm. Wenige Tage später rauscht das Gas wieder. „Diskursive Diplomatie“ nennt Lambsdorff die Methode – und die kann auch anderswo viel Gutes tun.

„Kara-kal-pak-stan“, buchstabiert Elisabeth Jeggle (Foto). Sie hat noch immer Mühe, den Landesnamen richtig auszusprechen. „Karakalpakstan ist ein Non-Land rund um den Aralsee, wo die Kinder mit TBC auf die Welt kommen.“ Noch nie, sagt Jeggle, eine Landwirtin und CDU-Abgeordnete aus der Nähe von Ulm, habe sie „so viele, so dünne Kinder“ gesehen. „Als ich dort ankam, haben sie uns englische Willkommenslieder gesungen, einige haben sich an mich geklammert. Das hat mich so beeindruckt.“ Seitdem kümmert sich Jeggle neben ihrer Arbeit im Agrarausschuss um eine förderliche Zukunft Zentralasiens. Sie reist nach Usbekistan, Kasachstan, besichtigt an der Seite des Roten Kreuzes ein Gefängnishospital, holt Praktikanten aus der Region in ihr Büro, mahnt bei Außenministern die Menschenrechte an.
„Diese Länder“, sagt Jeggle und macht blinkende Handbewegungen, „gucken mit solchen Augen auf uns. Es hat Wirkung, was wir sagen. Das Sehnsuchtsziel der Menschen dort heißt nicht Amerika. Sondern Europa.“ Mit genauso großen Augen, gibt Jeggle zu, schauen sie ihre Wähler daheim in Württtemberg an, wenn sie ihnen ihre Reisegeschichten auftischt. „Natürlich fragen die mich, ob ich keine anderen Probleme habe, für die ich Steuergelder verschwenden könnte. Aber dann sage ich ganz offen: Ich will, dass es diesen Ländern besser geht. Weil es Menschen gibt, die in den vergangenen 50 Jahren nicht so viel Glück hatten wie wir.“ Dem Auswärtigen Amt ist das Engagement von Jeggle willkommen. Sie und andere EU-Parlamentarier bilden eine sanfte Vorhut Europas, die sich nicht an die üblichen protokollarischen Beschränkungen von Staatendiplomatie halten muss. Außenpolitik per menschlicher Osmose, wenn man so will.
Steuergelder verschwendet das Europaparlament derweil auf andere Art. Der Versöhnung Europas soll der Legende die Regelung dienen, das Parlament an zwei Standorten tagen zu lassen. Alle drei Wochen brechen Lastwagenkolonnen aus dem Brüsseler EU-Viertel auf nach Straßburg, bepackt mit Aktenkisten von sämtlichen Abgeordnete, Assistenten und Übersetzern die per Bahn, Auto oder Flugzeug ins Elsaß nachkommen. Was diese Pendelei in Wahrheit demonstriert, ist die Unversöhnlichkeit der französischen Regierung mit dem Gedanken, auf eine Spesenschleuder zu verzichten, die vor allem Straßburgs Gastronomie- und Taxigewerbe Spitzenumsätze garantiert. Schätzungsweise 250 Millionen Euro kostet dieser Irrsinn die Wähler jedes Jahr.

In der letzten Straßburg-Woche vor Beginn des Wahlkampfes begrüßt die Abgeordneten vor dem eindrucksvollen Ovalbau ein großer, aufgeblasener Seehund. Drinnen, vorm Abstimmungssaal, verteilen schlanke Blondinen puschelige Stoffrobben. „Ihr könnt Geschichte machen!“, appellieren die Tierchen auf angetackerten Zetteln. „Beendet den Fellhandel!“
„Vielleicht sollten wir im 3. Stock noch ein Kinderkarussell aufstellen“, spottet Werner Langen, „dann wäre der Zirkus perfekt.“ Der 59 Jahre alte Ingenieur aus Rheinland-Pfalz ist ein humorvoller Mensch. Zugleich gilt der Chef der CDU/CSU-Gruppe als einer der mächtigsten Politiker im Parlament. Das bunte Treiben der Lobbyisten auf den Fluren gehe ihm zunehmend auf die Nerven, sagt er. Und gibt ihm selben Atemzug zu, dass er selber einer ist. Das Straßburger Abgeordnetencafé halt von temperamentvollen Gesprächen italienischer und französischer Abgeordneten wider.
„Natürlich“, sagt Langen und hebt die Stimme, „verteidigen wir hier die Interessen der deutschen Autoindustrie.“ Er selbst hat federführend dafür gesorgt, dass der Grenzwert für den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2020 auf lediglich 95 Gramm pro gefahrenem Autokilometer begrenzt wird. Ein niedrigerer Grenzwert könnte schießlich dem deutschen Limousinenbau schaden. „Jeder hat hier seine Interessen, bei denen die Gemeinsamkeit aufhört“, sagt Langen. Bei den Briten ist es das Bankenwesen, bei den Franzosen sind es die Agrarsubventionen.
Echte Politik, siehe an, es gibt sie im Europaparlament. Doch sie ist von viel bürokratischerer, technischerer Art, als ein Daniel Cohn-Bendit sie erträumt. Vielleicht ist dieses seltsame Organ ja am besten als Leatherman-Parlament beschrieben. Viele, mitunter zu viele kleine Schraubenzieher bilden sein Mittelarsenal, dazu eine beachtliche Kneifzange – sowie ein Fächer überflüssiger Gimmicks, die es eher zum Schmuck ausklappt. Keine große Keule eben. Ist es eher ein Feinwerkzeug für Liebhaber leiser politischer Mechanik.