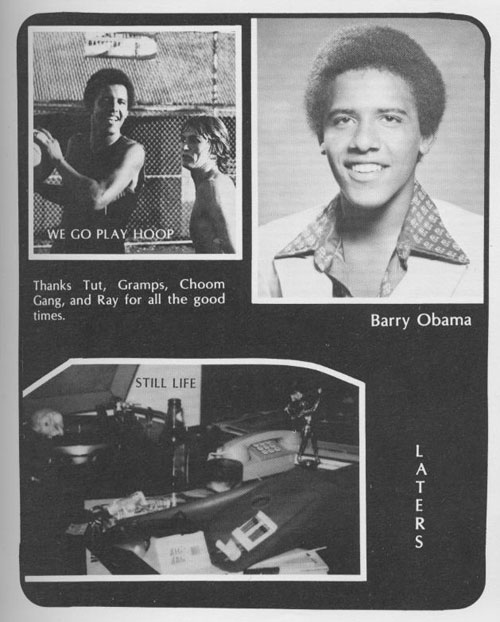Iran hat gestern Raketen getestet, die von ihrer Reichweite her geeignet wären, Israel oder amerikanische Basen im Nahen Osten zu treffen.
Das ist die jüngste Eskalationsstufe in einem sich erhitzenden Streit um das iranische Atomprogramm. Vor kurzem erst hatte Israel eine Übung über dem Mittelmeer durchgeführt, die als Demonstration der Stärke gegenüber Iran gesehen wurde.
In diesem Zusammenhang ist ein Streit interessant, der vor einigen Monaten aufkam. Darin geht es darum, obder iranische Präsident wirklich im Oktober 2005 gesagt habe, Israel müsse „von der Landkarte getilgt werden“. Die Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur hatte in der Süddeutschen diese Lesart der Rede in Frage gestellt.(Eine Antwort der Islamwissenschaftlerin Mariela Ourghi findet sich hier.)
Amirpurs stärkstes Argument zur Relativierung der Äußerungen des iranischen Präsidenten bezieht sich allerdings gar nicht auf den Wortlaut seiner Äußerungen, sondern auf seine verfassungsmäßige Stellung im Herrschaftssystem des Iran. Er sei nicht der Oberbefehlshaber (sondern der Revolutionsführer Chamenei). Er könne also gar nicht über Krieg und Frieden entscheiden. Seine Äußerungen erscheinen daher irrelevant, zumal sich Chamenei distanziert habe.
Das ist zunächst ein valides Argument, das geeignet erscheint, die israelische Debatte zu entdramatisieren. Nur weil Ahmadinedschad etwas gegen „das Regime, das Jerusalem besetzt hat“ sagt, läßt das noch nicht auf eine unmittelbare Bedrohung Israels schliessen.
Aber irrelevant ist es wohl auch nicht, was der gewählte Präsident sagt (auch wenn er mit Tricks an die Macht kam). Er spricht zwar nicht für das gesamte iranische System, aber wohl doch für den stärker werdenden militärisch-revolutionären Apparat, wie er in den Revolutionsgarden und den Bassidsch organisiert ist und immer mehr auf den iranischen Staat zugreift.
Und dann lohnt es sich vielleicht doch zu prüfen, ob die Rede tatsächlich nur eine Prophezeiung über das Ende des „Besatzerregimes“ enthält, wie Amirpur suggeriert. Anders gesagt: Was heißt für ihn eigentlich „Besatzerregime“?
Ich halte Amirpurs Lektüre für unhaltbar und verharmlosend. Davon kann sich jeder überzeugen, der bei der Bundeszentrale für Politische Bildung die komplette Neuübersetzung der Rede durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages liest.
– Eingangs der Rede ermahnt Ahmadinedschad seine Zuhörer, dass sie, wenn sie die Parole „Tod Israel“ [marg bar Isrāyīl] auszurufen hätten, sie diese Parole „richtig und von Herzen“ ausrufen sollten
– wenn Achmadinedschad vom „Besatzerregime“ spricht, meint er nicht die konkrete israelische Besatzung der Westbank oder von Teilen Jerusalems, sondern Israel per se
– er spricht in der Rede davon, dass das „Regime welches Jerusalem eroberte“ vom „hegemonialen System und der Arroganz“ (i.e. der Westen) gegründet worden sei, was ein „schweres Vergehen … gegen die islamische Welt“ darstelle: „Zwischen der Welt der Arroganz und der Welt des Islam tobt ein historischer Kampf, welcher Hunderte von Jahren zurückreicht.“ Das stellt die Gründung Israels in den Zusammenhang einer vermeintlichen Verschwörung der westlichen „Arroganz“ gegen den Islam. Die Gründung Israels ist also ein kriegerischer Akt in einem jahhrundertealten Konflikt. Es geht mithin um weit mehr als Palästina und die Rechte der Palästinenser.
– Ahmadinedschad sagt: „Während dieser letzten 300 Jahre brachen die letzten Bollwerke der islamischen Welt zusammen und die Welt der Arroganz gründete das Regime, das Jerusalem besetzt hält als einen Brückenkopf für die Herrschaft über die islamische Welt.“
– der Präsident führt aus, dass „Brückenkopf“ ein militärischer Fachausdruck sei: „Wenn zwei Gruppen oder Heere aufeinander treffen, und eine Seite die Initiative ergreift und zur gegenüberliegenden Seite hin vorstößt, einen Abschnitt des Territoriums erobert und es befestigt; wenn sie dann zur Verstärkung dort eine Festung errichten um die [eigene] Zone auszuweiten‚ dann nennen wir dies einen Brückenkopf.“ Also betrachtet er Israel im Ganzen als militärische Einrichtung des Westens. Und in einem Brückenkopf gibt es keine Zivilisten – dies ist mithin eine implizite Rechtfertigung jeglichen Angriffes auch gegen einfache Bürger Israels.
– entsprechend heißt es in der Rede weiter: „Dieses Besatzerregime stellt tatsächlich einen Brückenkopf der Welt der Arroganz im Herzen der islamischen Welt dar. Sie haben eine Festung errichtet, von der sie ihre Herrschaft auf die gesamte islamische Welt ausdehnen wollen. Darüber hinaus gibt es weder Grund noch Zweck für dieses Land.“ Weder Grund noch Zweck! Das bedeutet: Kein Existenzrecht!
– in diesem Kontext ist nun der betreffende Satz zu bewerten, um den es in dem Streit vordergründig geht. Ahmadinedschad bezieht sich damit auf den Titel der Konferenz: „Eine Welt ohne Zionismus“. Ist das überhaupt möglich, so sagt er, fragen viele. Und dann zählt er den Niedergang des Schahregimes, den Niedergang des Kommunismus und den Fall Saddams auf – Ereignisse, die auch niemand für möglich gehalten hätte. Aber Khomeini hätte diese Dinge immer schon vorausgesagt. Dann kommt der entscheidende Satz:
– „Unser lieber Imam [Khomeini] sagte auch: Das Regime, das Jerusalem besetzt hält, muss aus den Annalen der Geschichte [safha-yi rōzgār] getilgt werden. In diesem Satz steckt viel Weisheit. Das Palästina-Problem ist keine Frage in welcher man in einem Teil Kompromisse eingehen könnte.“ Das „Palästina-Problem“ besteht in der Existenz Israels.
– man muss den Satz schon komplett aus dem Kontext reissen, um suggerieren zu können, der iranische Präsident kritisiere hier bloss die Besatzung Jerusalems und der Westbank und fordere im Einklang mit UN-Resolutionen deren Ende
– der „unrechtmäßige Zustand“, den der iranische Präsident beenden will, ist nicht weniger als die Existenz Israels. Daran läßt seine Rede keine Zweifel. Das „Regime, das Jerusalem besetzt hält“, ist der Staat Israel. Selbst nach einem Ende der Besatzung gäbe es in Achmadinedschads Logik für Israel „weder Grund noch Zweck“
– es geht hier also nicht um die Rückgabe besetzter Gebiete, sondern um das Auflösung des Staates Israel und mehr noch die Löschung Israels aus der Geschichte. Es ist die Pflicht der Muslime, in dem Jahrhunderte alten Kampf für diese Revision des Unrechts zu arbeiten. Das Unrecht besteht in der Existenz dieses Staates Israel per se, für den es „weder Grund noch Zweck“ gibt, ausser der Eroberung der islamischen Welt als Brückenkopf zu dienen. „Wipe off the map“ (im deutschen als „von der Landkarte tilgen“ wiedergegeben) beschreibt das Ziel Ahmadinedschads also zutreffend, selbst wenn es sich dabei nicht um eine wörtliche Übersetzung handelt. Es ersetzt eine zeitliche Metapher („aus den Annalen oder Seiten der Geschichte tilgen“) durch eine räumliche („von der Landkarte tilgen“).
Über die passendere Wiedergabe des Sinnes läßt sich ein Geschmacksstreit führen, in der Sache bleibt er irrelevant, wie die genaue Lektüre der Rede zeigt:
– Im übrigen, wenn man einmal bei der wörtlichen Übersetzung bleibt: ein „Regime aus den Annalen der Geschichte tilgen“ Bedeutet das: Nicht einmal eine Erinnerung in den Annalen soll von Israel bleiben, Israel soll ungeschehen gemacht werde? Ist das kein Vernichtungswunsch?
– Ahmadinedschad will keinen Zweifel an seiner Absicht lassen: „Kann eine [gemeinsame] Front es dulden, wenn in ihrer Mitte eine fremde Macht entsteht? Dies würde eine Niederlage bedeuten und wer immer die Existenz dieses Regimes anerkennt, hat in Wirklichkeit die Niederlage der islamischen Welt unterschrieben.“
– Er sagt weiter: „Unser lieber Imam [Khomeini] hat in seinem Kampf gegen die Welt der Arroganz das Regime, das Jerusalem besetzt, zu seinem Hauptangriffspunkt gemacht. Ich zweifle nicht daran, dass die neue Welle, die im geliebten Palästina begonnen hat, und welche wir heute in der islamischen Welt beobachten, eine Welle der Moral ist. Sie hat die gesamte islamische Welt erfasst und wird sehr bald den Schandfleck [Israel] aus dem Schoß der islamischen Welt beseitigen – und das ist machbar.“
– Später wiederholt er, die „Eliminierung des zionistischen Regimes (wird) glatt und einfach sein“.
Ahmadinedschad erklärt schließlich noch, dass die Palästinenser selbst gar nicht über diese Dinge entscheiden können. (Sie wären also auch nicht zu einer Verhandlungslösung autorisiert.) Die Palästinafrage ist nämlich das Problem der gesamten islamischen Welt: „Menschen, die in einem geschlossenen Raum sitzen, können darüber nicht entscheiden. Das islamische Volk kann es nicht erlauben, dass diese historische Feindschaft im Herzen der islamischen Welt existiert.“
Zusammengefasst: Der Gesamtkontext der Rede, so wie sie komplett vom Sprachendienst des Bundestages übertragen wurde, lässt keinen anderen Schluss zu, als dass der iranische Präsident
– Israel jegliche Legitimität abspricht
– Israel als Teil einer westlichen Verschwörung gegen „den Islam“ betrachtet
– die „Eliminierung“ Israels darum als Pflicht jedes Muslims in einem jahrhundert alten Kampf begreift
– schon die Anerkennung der Existenz Israels als Einwilligung in die Niederlage des islamischen Welt versteht
– der Jugend Mut machen will, sich nicht entmutigen zu lassen beim Kampf gegen Israel, denn die „Beseitigung dieses Schandflecks im Schoß der islamischen Welt ist machbar“.
Diese Rede – das will ich hier klar sagen – ist trotz ihrer Anstößigkeit keine Rechtfertigung für einen Krieg gegen Iran. Sie steht im Widerspruch zu dem, was die Mehrheit im Iran denkt, und bildet auch keinen Konsens im Herrschaftsapparat des Landes ab.
Aber sie gibt durchaus Grund zur Sorge. Es ist inakzeptabel, dass der Präsident des Iran solche massiven Drohungen gegen einen anderen Staat ausspricht und ihm sein Existenzrecht bestreitet.
Wir dürfen diese Rede nicht aus Furcht vor einem Krieg verharmlosen. Sie bleibt eine Ungeheuerlichkeit. Es steht zu hoffen, dass das iranische Volk bei den Wahlen im nächsten Jahr diesen Schandfleck aus seiner Mitte entfernt.