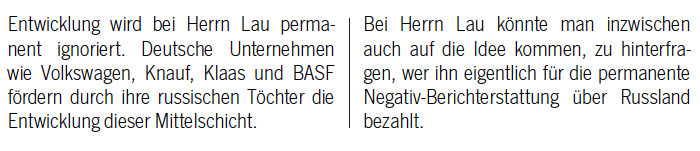Am vergangenen Donnerstag habe ich in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik diesen Vortrag gehalten – als Antwort auf den Direktor des Thinktanks der DGAP, Professor Eberhard Sandschneider. Angeregt durch unsere ZEIT-Debatte zur Außenpolitik wird die DGAP eine Reihe über das Verhältnis zwischen Werten und Interessen in der deutschen Außenpolitik veranstalten. (Wir werden berichten.) Am Donnerstag war die Auftaktveranstaltung.
Ich muss diesen Vortrag mit einer diplomatischen und menschlichen Unmöglichkeit beginnen. Was ich jetzt gleich tun werde, ist wirklich das Letzte. Ich werde mich selbt zitieren.
Verzeihen Sie, aber hier und heute kann ich es mir nicht verkneifen.
Vor nicht ganz zwei Monaten habe ich in der ZEIT geschrieben:
Wie wenig Stabilität taugt, die auf Kosten von Freiheit und Menschenrecht geht, zeigen heute die Eruptionen in den arabischen Ländern. Die fortschreitende Implosion der Staatenwelt des Nahen Ostens stellt auch einen vermeintlichen Realismus bloß, der sich nicht traute, über die Gewaltherrscher hinauszudenken. Das einflussreiche Milieu der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik wäre eigentlich der Ort für solche Reflexionen.
Als Journalist hat man nicht oft einen unmittelbaren Effekt mit kritischen Äußerungen. Um so mehr freue ich mich, dass die DGAP mit Herrn Professor Sandschneider den Ball aufgenommen hat und die Debatte weiterführen möchte, sogar mit einer ganzen Reihe von Vorträgen. Statt mir die DGAP-Mitgliedschaft zu kündigen, hat man mich hier eingeladen. Das ist großzügig und zeugt von Sportsgeist.
Und damit in den Ring:
Lieber Herr Sandschneider – einerseits sagen Sie: Es gibt neue Wertekonflikte, die sich aus dem Aufstieg neuer Mächte ergeben – und aus deren Anspruch, ihre eigenen Werte durchzusetzen. Der Westen bestimmt nicht mehr die Regeln.
Zweitens sagen Sie aber, es gibt eigentlich keinen Konflikt zwischen unseren Werten und unseren Interessen, das wird nur künstlich von Moralisten hochgespielt, die von Außenpolitik keine Ahnung haben.
Also was denn nun?
Ich finde, die beiden anfangs zitierten Aussagen passen nicht recht zusammen. Und möchte dagegen stellen: Es gibt tatsächlich einen globalen Wettbewerb, in dem unsere Werte – die der freiheitlichen und offenen Gesellschaften, durchaus nicht mehr nur des klassischen alten „Westens“ – herausgefordert und in Frage gestellt werden. Sie können das auf die einfach Frage reduzieren: Wer kommt besser durch die Krise – die freien Gesellschaften, oder die Gelenkten, die zigfach ausdifferenzierten Formen von Tyrannei, die wir heute sehen können?
Ich sehe eigentlich nicht die von Ihnen so häufig beschworene Gefahr des Predigens und Missionierens durch den Westen – sondern eher die einer Verzagtheit – aufgrund von bererchtigten und unberechtigten Selbstzweifeln. Denn: Ob es eigentlich noch legitim ist und erfolgsversprechend, für unsere Idee der Moderne einzutreten – in der wirtschaftliche und gesellschaftlich-politische Öffnung Hand in Hand gehen –, das ist zweifelhaft geworden.
Und selbstverständlich geraten deshalb in der Außenpolitik immer wieder Werte und Interessen aneinander.
Es kann unangenehm, unbequem, teuer sein, sich der Demokratie, den Menschenrechten, dem Rechtsstaat und den Bürgerfreiheiten verpflichtet zu wissen. Es stört manchmal vielleicht die Geschäfte. Nicht so oft, wie suggeriert wird, übrigens, ich komme gleich drauf. Es stört aber womöglich das außenpolitische Geschäft mit den herrschenden Eliten in manchen Ländern, die ihre Gesellschaften nicht öffnen wollen.
Es wird maßlos und strategisch – mit Absicht – übertrieben, welche negativen Konsequenzen eine Politik klarer Worte hat.
Vor allem von denen, die immer sagen: Bitte nicht so laut, bitte nicht auf dem Marktplatz, nicht in den Medien! Dazu ist zu sagen: natürlich sind Marktplatz und Megaphon nicht die erste Wahl! Allerdings ist das ja erstens auch gar nicht der Alltag deutscher Menschenrechtsdiplomatie. Die findet natürlich im Stillen statt. Manchmal aber – zweitens – muss es laut und deutlich sein.
Nehmen wir das letzte Jahr: Laut Ostausschuss der dt. Wirtschaft das bisher erfolgreichste beim Handel mit Russland. Tolle Wachstumsraten, tolle Zufriedenheit! Zugleich hat Deutschland noch nie zuvor so deutliche Worte gefunden für die undemokratische Tendenzen des Regimes Putin. Das Auswärtige Amt hat zwar versucht, eine Resolution des Bundestages im letzten Herbst abzumildern. Zum Glück aber ist das wegen öffentlichen Drucks nicht geschehen, und der Bundestag hat mit breiter Mehrheit Putins Rückabwicklung von Rechtsstaat und Demokratie scharf gegeißelt.
Dessen ungeachtet sind 80 Prozent der deutschen Unternehmen optimistisch, was das kommende Jahr angeht. Eigentlich sollte das nicht zusammenpassen. Diese Entwicklung widerspricht den Appellen zur Leisetreterei, die immer mit dem Argument daherkommen, wir würden uns Zugänge verspielen, wenn wir uns für Bürgerrechte einsetzen.
Wir sollten uns nicht kleiner machen als wir sind.
Was heißt das übrigens, dass der Westen nicht länger „die Regeln“ bestimmt, wie Sie ja auch gerade wieder in Ihrem Vortrag ausgeführt haben, Herr Sandschneider? Das ist eine merkwürdige postkoloniale Polemik, mit der oft blanke Interessen der anderen Seite aufgehübscht werden: Wenn man das Copyright nicht akzeptiert, sich übers Patentrecht hinwegsetzt, wenn die Korruption gedeiht, wenn Minderheiten und Andersdenkende unterdrückt werden, wenn Wahlen manipuliert und Medien behindert werden, dann kommt diese Polemik auffällig oft zum Einsatz. Wir sollten diese Propagandamasche unterdrückerischer Regime nicht mitmachen. Es geht in Wahrheit um universalisierte Normen, zu denen sich – jedenfalls auf dem Papier – nahezu alle Staaten bekennen.
Beruhen die UN-Menschenrechtskonventionen auf „westlichen Werten“? Warum werden sie dann so breit ratifiziert? Gerhart Baum hat bei uns in der ZEIT vor einigen Wochen noch einmal klar gestellt: „Niemand diktiert der Welt ihre Werte – weder der Westen noch die deutsche Außenpolitik. Die Werte wurden in einem beispiellosen historischen Akt 1949 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen niedergelegt. Das war eine Reaktion auf die Schrecken der ersten Hälfte des dunklen 20. Jahrhunderts. In der Präambel heißt es: ‚Die Verkennung und Missachtung der Menschenrechte hat zu Akten der Barbarei geführt, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben.’“
Betonung: „Gewissen der Menschheit“. Nicht „der westlichen Welt“.
Und was soll es heißen, dass die Politik „externer Demokratisierung“ gescheitert sei? Dass deutsche Außenpolitik, wie Sie sagen, zwar besser ist als ihr Ruf, aber immer dann desaströse Ergebnisse zeitigt, wenn sie ihre Wertegebundenheit nach außen kehrt? Mit Sicherheit ist es richtig, die Zielsetzung des Afghanistan-Krieges und des gesamten neuen Interventionismus der letzten 15 jahre einer kritischen Revision zu unterziehen.
Die Politik scheut davor zurück und reagiert mit einer klammheimlichen, nichterklärten Doktrin des Sichraushaltens in Kombination mit einer Lockerung der Waffenexportpolitik – explizit auch an undemokratische Mächte in Spannungsregionen wie Saudi-Arabien.
Ist das die richtige Konsequenz aus einer Ernüchterung beim Interventionismus? Stabilität schaffen mit immer mehr Waffen? Wer kann nach den Ereignissen der letzten Jahre in Arabien noch seine Hand für das Staatsmodell Saudi-Arabien ins Feuer legen?
Das neue Selbstbewußtsein der aufstrebenden Länder, das Sie immer wieder betonen, Herr Sandschneider, ist eine gute Sache – da, wo es auf Leistung und Reformbereitschaft mindestens im ökonomischen Bereich beruht, wie vor allem in China, aber auch in Lateinamerika und Afrika. Darüber sollten wir froh sein. Davon haben wir nichts zu berfürchten außer belebender Konkurrenz.
Zu unterscheiden ist davon die postkoloniale Propaganda autoritärer Regime, mit der gesellschaftliche Reformen abgewehrt werden sollen, weil sie schlicht die etablierte Herrschaft gefährden.
Meine Erfahrung ist: Wann immer das kulturrelativistische Argument kommt, dieser oder jener Wert tauge nicht für diese oder jene Kultur, ist meist etwas faul. Es klingt ja nicht grundsätzlich falsch, wenn vom Pluralismus der Lebensformen die Rede ist. Aber es wird natürlich oft strategisch eingestezt, gerade um Pluralismus zu verhindern! Ein Beispiel:
Kürzlich habe ich einen russischen Außenpolitiker getroffen, der im System Putin eine wichtige Größe darstellt. Wir hatten über Syrien, die Eurokrise, das iranische Atomprogramm und die Spannungen mit den USA diskutiert.
Doch richtig lebhaft wurde das Gespräch, als die Rede auf das Gesetz gegen die „homosexuelle Propaganda“ kam, das russischen Schwulen und Lesben ab dem Januar verbietet, über ihre sexuelle Orientierung zu reden.
Sehen Sie, sagte mein Gegenüber, warum regen Sie sich darüber auf? Wir drücken Ihnen in Deutschland doch auch nicht unsere Werte auf? Das ist eine russische Angelegenheit.
Wir haben das Recht, unsere Gesellschaft, unsere Familien, unsere Kinder vor diesen Erscheinungen zu schützen. Das ist nicht gesund für eine Gesellschaft. Wir wollen nicht, dass dieser Lebensstil sich verbreitet, aber wir kommen nicht zu ihnen und greifen Sie an, weil sie ihn dulden.
In Rußland aber haben wir Maßnahmen dagegen ergriffen. Das ist unser Recht. Sehen Sie, der Westen durchläuft gerade eine liberale Revolution – alles wird erlaubt, alle Lebensformen, alle Glaubenssysteme sind gleichwertig. Man kann aber solche Werte nicht importieren. Sie können nicht nach Moskau kommen und uns befehlen, diese liberalen Werte anzunehmen.
Sie im Westen durchlaufen eine liberale Revolution. Russland durchläuft eine konservative Revolution.
Das heißt in Wahrheit, ich übersetze das mal, „wir haben das Recht unsere Minderheiten zu unterdrücken, wie es uns passt“.
Soll die deutsche Regierung dazu schweigen? Ich glaube, das geht nicht mehr, gerade weil wir immer mehr mit Russland verflochten sind, und weil wir das gerne noch weiter treiben wollen. Russland hat die Europäische Menschenrechtskonvention unterschrieben. Russland will zu Europa gehören, seine Eliten schicken ihre Kinder hier zur Schule, sie kaufen Häuser und legen Geld in Europa an. Wer die Integration und Verflechtung unserer Gesellschaften befürwortet, kann Menschenrechtsverletzungen nicht ignorieren. Und da ist dieser Fall natürlich nur ein Symptom, aber ein wichtiges. Er ist ein Test dafür, ob wir uns und unsere Werte noch ernst nehmen.
Aber treten wir noch mal einen Schritt zurück.
Ich möchte hier kurz einige Elemente der Polemik gegen „überzogene Werte- und Moralbezüge“ aufgreifen, wie sie – prominent von Ihnen, Herr Sandschneider – immer wieder vorgebracht werden:
Erster Vorwurf: Der Westen hält sich nicht an seine eigenen Werte, darum soll er andere nicht belehren.
Ersteres ist leider sehr oft richtig. Das Zweite geschieht kaum noch. Im Gegenteil greift eine merkwürdige Verzaghtheit um sich, die aus westlichem Selbstzweifel gespeist wird: Es steht in Frage, ob unsere Gesellschaften am Ende die leistungsfähigeren sind. Das ermutigt die andere Seite, die Despotie als effiziente Alternative zu verkaufen. Dem muß man entgegentreten.
Zweiter Vorwurf: Der Westen missioniert die Welt mit seinen Werten und gibt sie doch für universale aus. Das ist eine Variante eines alten deutschen Vorurteils gegen den Westen, historisch besonders gegen die Briten: Werte sind nur Cover für Interessen. „Sie sagen Christus und meinen Kattun.“ (Fontane) Diese antiwestliche Tradition hat Deutschland in den Abgrund geführt. Ich verspreche mir nichts davon, daran anzuknüpfen.
Im Gegensatz dazu wird behauptet, dritter Vorwurf: Wer öffentlich von seinen Werten redet, will sich eigentlich nur selbst bespiegeln. Das kann natürlich vorkommen. Aber manchmal ist es wichtig zu zeigen, wer man ist und wo man steht – auch um der anderen Seite Ernst genommen zu werden. Ich stelle mir vor, dass der russsiche Präsident Putin eine ziemlich nüchtern-robuste Sicht der deutschen Außenpolitik hat: Ihr kritisiert uns zwar für Pussy Riot und für Chodorkowski und die NGO-Razzien, macht aber weiter „Rechtsstaatsdialog“, als wäre nichts passiert – wie verlogen ist das denn? Und ich soll Euch ernst nehmen? Ihr nehmt euch ja selber nicht ernst.
Vierter Vorwurf: Wertebezogene Politik wird nur fürs „Schaufenster“ beziehungsweise „die Medien“ gemacht. Das ist nicht auszuschließen, und es kann natürlich im Einzelfall falsch sein. Es kann dann größerer Schaden entstehen als bei einer leisen Vorgangsweise. Aber: Dass Diplomatie bei uns unter Druck steht, sich vor dem heimischen Publikum zu rechtfertigen, ist einerseits lästig für die Politik, kann aber auch eine Stärke sein.
Es gibt der Regierung ein Argument an die Hand: Wir wollen ein gutes Verhältnis, aber wir können euer Verhalten bei unseren Leuten nicht mehr rechtfertigen. Wenn ihr so weiter macht, kommen wir in ernsthafte Schwierigkeiten zuhause. Wir wollen uns für euch einsetzen, aber wir können das immer schwerer verkaufen….
Anders als in Zeiten des Kalten Krieges braucht in der globalisterten Welt von heute jeder schwierige Partner die Gewogenheit der Öffentlichkeit, auch der Öffentlichkeit hier bei uns, und das ist gut so. Darum wollen alle die Olympischen Spiele und die Fussball WM ausrichten. Und darum geht es einigen Lobbyfirmen hier in Berlin, die den Job der Aufhübschung von Autokraten machen, ziemlich prima.
Fünfter Vorwurf: Wertegeleitete Politik ist irrelevante „Symbolpolitik“ – im Gegensatz zur harten Realpolitik.
Das hat noch nie gestimmt, und es ist heute erst recht nicht wahr. Symbolik ist wichtig. Wenn Symbolpolitik so irrelevant ist, warum waren die Chinesen so verschnupft wegen der Sache mit dem Dalai Lama? Warum ist die israelische Regierung nachhaltig irritiert über eine deutsche Enthaltung vom letzten Herbst, als es um das Upgrade der Palästinenser in die Uno ging? Symbolpolitik ist eine schwierige, harte Sache.
Sechster Vorwurf: Werte lassen sich nicht exportieren/ eins zu eins übertragen/ verpflanzen.
Das ist eine Binsenweisheit. Und damit natürlich richtig – und falsch zugleich. Reeducation in Deutschland war offenbar ein Erfolg, Nationbuilding im Irak scheint eher ein Misserfolg zu werden.
Aus dem letzteren in eine Doktrin der Nichteinmischung zurückzufallen, wäre falsch und unzeitgemäß. Die Überdehnung westlicher Politik unter George W. Bush ist eine fatale Tatsache – aber warum soll dafür Amnesty büßen, oder „Memorial“ in Russland?
Siebter Vorwurf: Wir brauchen die Autokraten, Nichtdemokraten und Scheindemokraten zur Lösung internationaler Probleme und wegen der Rohstoffe, darum sollten wir lieber schweigen. Wenn wir zu laut sind, fühlen sie sich zurückgewiesen, vertrauen uns nicht mehr und kooperieren nicht mehr.
Ersteres stimmt zweifellos, das zweite nicht. Wir brauchen sie, aber sie uns auch. Auch die andere Seite hat Interessen, die sie an uns bindet. Es ist legitim, dass wir das nutzen.
Achter und letzter Vorwurf: Der Westen und auch Deutschland wenden seine Werte nur selektiv an – da, wo es gerade passt und keine negativen Rückwirkungen zu befürchten sind. Er kritisiert schwächere Länder, die sich nicht wehren können, lässt Saudi-Arabien aber zum Beispiel ungeschoren – wegen des Öls und der Bedeutung als „moderate“ Macht in der Region. Weil westliche Werte immer wieder mit doppelten Standards zur Anwendung kommen, sind sie diskreditiert.
Doppelmoral ist in der Tat ein Problem. Zwar wäre es naiv zu glauben, sie ließe sich ganz vermeiden oder durch reine Moralpolitik ersetzen. Das fordert auch niemand! Außenpolitik hat viele Interesssen abzuwägen – Friedenssicherung, Energiesicherheit, Umweltschutz, Wirtschaftsinteressen. Dabei müssen moralische Bedenken oft zurückstehen.
Aber nichts davon, kein einziges Ziel der deutschen Außenpolitik ist langfristig ohne das Drängen auf gesellschaftliche und politische Öffnung zu sichern. Das ist der harte Kern einer realistischen Moralpolitik, um die wir zum Glück endlich streiten.