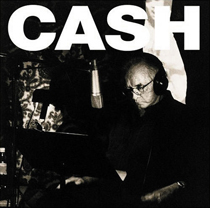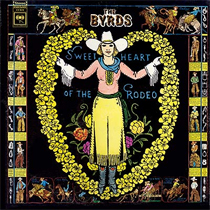Seit 28 Jahren hat Larry Jon Wilson keine Platte mehr aufgenommen. Jetzt setzte er sich in Florida ans Fenster und zupfte ergreifende Lieder, als sei kein Tag vergangen.
Der sanftgebügelte Klang der Fiedel umfängt die Zuhörer, ein schunkelnder Rhythmus fordert sie zum Mitklatschen auf. Das ist eine Sensation, heute Abend und hier in Nashville stehen drei Legenden auf einer Bühne: Billy Ray Cyrus, Shania Twain und Garth Brooks. Sie haben die elektrischen Gitarren umgeschnallt und schicken geschliffene Akkorde ins dankbare Publikum. Keine fünf Minuten hält Kris das aus, »Country kann so abgeschmackt sein«, denkt er sich, »die Neunziger ätzen mich an«. Er geht hinaus…
… geht fünfzehn Jahre zurück. Ein paar Straßen weiter biegt Kris links ab, in eine dunkle Gasse. Dann wieder links, einmal halbrechts, ein paar hundert Meter geradeaus und rechts eine halbe Treppe hinab. Hier haben er und seine Freunde Nashville neu aufgebaut, hier versammeln sich die Country Outlaws in einem winzigen, gemütlichen Kellerstübchen. Johnny Cash ist da und Waylon Jennings, selbst Willie Nelson. Kris lässt sich nieder.
Auf der Bühne steht sein Freund Larry, Larry Jon Wilson. Er hat gerade begonnen zu spielen, allein mit seiner Gitarre und seiner Stimme erfüllt er den Raum und die Menschen mit Leben. Im Bariton grummelt er beseelte Geschichten, banale und dramatische. Sein Country ist nicht glatt, nein, hier schwingen Soul und Blues mit, seine Akkorde sind rau. Am Ende steht das Publikum und applaudiert, vier-, fünfmal muss Wilson auf die Bühne zurückkehren, einige Lieder spielt er doppelt, weil er keine neuen mehr kennt. Alle sind gerührt, der Sänger nicht weniger als sein Publikum. »Dieser Teufelskerl«, flüstert Kris seinem Nebenmann zu, »er bricht dein Herz mit der Stimme einer Kanonkugel«.
Sein Freund steht noch immer auf der Bühne und bedeutet den Jubelnden, dass er noch etwas zu sagen habe. »Freunde… und ich weiß, dass alle, die heute Abend hier sind, meine Freunde sind… Das fällt mir jetzt nicht leicht. Es ist gar nicht lange her, zehn Jahre, da habe ich zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand gehalten, nicht hier in Nashville, sondern in Langley, South Carolina. Was ist alles passiert seither? Ich habe gelernt, sie zu spielen, habe meinen Job als Chemiker aufgegeben, habe mit der Hilfe vieler von Euch – Townes, Mickey… – ein paar Alben aufgenommen.« – »Und keine Schlechten, Mister Wilson!«, ruft ein sehr junger Mann dazwischen, viele im Publikum signalisieren lautstark ihre Zustimmung. »Mag sein«, fährt Wilson lächelnd fort, »gekauft hat sie trotzdem niemand, oder? Ich mache es kurz. Vielen Dank für alles, Freunde. Es war mir ein großes Vergnügen, Nashville mit euch gemeinsam hier neu aufzubauen, Stein für Stein! Es war eine schöne Zeit. Macht’s gut.«
»Du verdammter Dickkopf«, ruft Kris ihm hinterher, aber er weiß, das wird nichts ändern.
Achtundzwanzig Jahre später in Florida. Kris lehnt grinsend im Türrahmen und traut seinen Augen nicht. Da sitzt sein Freund Larry Jon Wilson am offenen Fenster – draußen rauscht der Atlantik. Er sitzt da mit seiner Gitarre, nur seiner Gitarre. In der Ecke steht ein Aufnahmegerät, es läuft die ganze Zeit. Wilson öffnet eine Dose Bier und wärmt seine Hände in der warmen Brise. Er stimmt Willie Nelsons Heartland an:
»There’s a home place under fire tonight in the heartland
And the bankers are taking my home and my land from me
There’s a big achin‘ hole in my chest now where my heart was
And a hole in the sky where God used to be
My American dream fell apart at the seams
You tell me what it means, you tell me what it means.«
»Warum ausgerechnet jetzt? Und warum hast du 28 Jahre gebraucht, diese fantastischen Lieder endlich aufzunehmen?« – »Ach weißt du, Kris. Ich wollte es einfach noch einmal versuchen, egal wie stümperhaft das klingt. Was meinst du?« Kris schnappt nach Luft, er kann es einfach nicht fassen.
Eine Woche lang nimmt Larry Jon Wilson auf, was ihm einfällt, die meisten Lieder komponiert er selbst. Freunde kommen vorbei und lauschen, reden. Die Erinnerungen verwandeln sich in Lieder, aus Liedern werden neue Erinnerungen. Er nimmt jedes Lied nur einmal auf, kein Produzent legt Hand an. Ein paar Mal spielt eine kaum hörbare Geige im Hintergrund, als käme sie aus dem Nebenzimmer. Wilson stört sich nicht an schiefen Tönen, entzupft seiner Gitarre ein paar intuitive Country- und Bluesakkorde und erzählt, was ihm einfällt. Er ergeht sich in Selbstmitleid: »I’d miss you, if I knew what I was missing«, singt er in der bewegenden Losers Trilogy – und rechnet ab. Er berichtet von düsteren Träumen und gescheiterter Liebe, aber seine warme Stimme gibt einem das Gefühl, das Leiden sei gar nicht so schlimm.
Ein paar Wochen darauf: Will Oldham eilt Nashvilles Hilsboro Road hinunter und stolpert ins Bluebird Café. Stolz wedelt er mit einer selbstgebrannten CD, die der Country-Haudegen Kris Kristofferson ihm gerade geschickt hat. »Liebe Leute, kauft euch diese Platte, bitte. Das hier sind zwölf Lieder, denen man anhört, dass sie aus der Tiefe kommen. Dagegen klingt selbst Johnny Cash überladen.«
Das unbetitelte fünfte Album von Larry Jon Wilson ist als CD bei 1965 Records/Alive erschienen. Die vier Alben, die er in den Jahren 1975 bis 1979 aufnahm, sind derzeit unverständlicherweise nicht erhältlich.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie COUNTRY
The Gentle Lurch: »From Around A Fire« (Schinderwies/Broken Silence 2007)
Bonnie Prince Billy: »The Letting Go« (Domino Records 2006)
Johnny Cash: »A Hundred Highways« (Mercury/Universal 2006)
The Byrds: »Sweetheart Of The Rodeo« (Columbia/Sony BMG 1968)
Okkervil River: »Black Sheep Boy & Appendix« (Virgin 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik