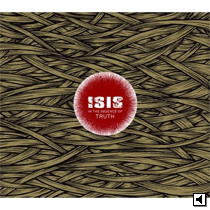„I saw the best minds of my generation destroyed“, raunt Rich Terfry alias Buck 65 gleich zu Beginn von Situation ins Mikrofon. Das sind, auch wenn sie vielleicht nicht mehr jeder kennt, die berühmten ersten Worte von Allen Ginsbergs legendärem Gedicht Howl, das 1957 wegen Obszönität vorübergehend verboten wurde. Gewiss kein schlechter Ausgangspunkt eines Liedtexts. Und wenn man etwas zu sagen hat, darf man sich getrost auch ein paar Wörtchen ausleihen.
Grandmaster Flashs The Message war der erste Rap, den Terfry seinerzeit auf der Rollschuhbahn des ostkanadischen 3000-Seelen-Nests Mount Uniacke hörte; damals war er zehn Jahre alt. Nur zur Erinnerung: Das Kürzel Rap steht nicht zuletzt für Rhythm and Poetry. Der Titel eines frühen Buck-65-Albums, Language Arts (1996), lässt keinen Zweifel daran, welchen Stellenwert Terfry dem Erzählen und dem Spiel mit der Sprache einräumt.
Auf späteren Alben orientiert sich sein rauer, unverkennbarer Wortfluss deutlich an den Markenzeichen des Beat-Poetry: der spontanen Prosa Jack Kerouacs und den Cut-Up-Techniken eines William Burroughs. Seine Erzählweise perfektionierte Buck 65 schließlich auf Talkin’ Honky Blues (2003). Auf diesem, seltsamerweise weithin unbemerkt gebliebenen Klassiker des Underground-Hiphop gelingt ihm das Kunststück, scheinbar völlig disparate Genres mit stupender Effektivität unter einen Hut zu bringen: Hiphop wird mit Folk, Country und Blues angereichert, als hätte eins seit jeher zum anderen gehört. Und so ist es ja auch, gemäß dem schönen Motto, dass es ohne Tradition keine Moderne geben kann.
Dabei verweist Buck 65 auf die New Yorker DJ-Legende Afrika Bambaata. „Er verstand sich und andere DJs als Musik-Anthropologen“, sagt Terfry. „Diese Vorstellung habe ich aufgegriffen und versucht, den Gedanken noch ein bisschen weiterzuspinnen. Ich bin weiter und weiter zurückgegangen, über die Traditionen New Yorks und Jamaicas hinaus bis zu den Wurzeln von Blues und Talking Blues. In der HipHop-Szene kann man mit derartigen Anschauungen allerdings keinen Blumentopf gewinnen. In der Szene bin ich immer ein Außenseiter geblieben“.
Womöglich auch deshalb, weil Terfry das mittlerweile dauersteife Gangster-Geschwafel stets außen vor gelassen hat. Mit Situation setzt er – nach der Best-of-Compilation This Right Here Is Buck 65 und dem eher unentschlossenen Album Secret House Against The World – den auf Talkin’ Honky Blues begonnenen Weg konsequent fort. Diesmal mit einer Hommage an ein fast vergessenes, im Rückblick allzu oft nur als borniert und verschnarcht wahrgenommenes Jahrzehnt.
Sein mittlerweile zwölftes Album bedient sich der Beats und Basslinien des Old-School-Hiphop. Er beschwört die Ikonen und Unruhestifter der Fünfziger in einem impressionistischen Rap-Bildersturm – und reimt folgerichtig Thelonious Monk auf Punk. Auf Situation besichtigt er eine Kulturrevolution. „Sicher, Punk war eine aufregende Sache“, sagt Terfry, „aber verglichen mit dem, was 1957 in musikalischer Hinsicht passierte, letztlich kaum mehr als ein Sturm im Wasserglas.“
Er denkt nicht daran, die Aufbruchsstimmungen von damals in Sound oder Samples zu reproduzieren. Er macht das, was er am besten kann: Er erzählt. Mit seinen nostalgischen Stimmungen und jazzigen Piano-Loops erinnert Situation nicht nur von fern an John Zorns Film-noir-Reverenz Spillane, sondern erweist sich als ebenso gekonnt intertextuelles Spiel mit Namen, Zitaten und Querverweisen.
Wenn die Geister von Charlie Parker, Eddie Cochran und Bettie Page in Buck 65s kehligem Rap aufeinander treffen, wird einmal mehr deutlich, dass sich Kultur nicht aus Genres, sondern aus Stil und Haltung speist. Und da wahre Kultur schon immer darin bestand, es anders zu machen, darf man Situation fraglos als ein großes Album betrachten: Selten ist es jemandem gelungen, moderne Americana so selbstverständlich zu einer Einheit zu verschmelzen.
„Situation“ von Buck 65 ist erschienen bei Strange Famous Records/Warner.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie HIPHOP
Missill: „Targets“ (Discograph/Rough Trade 2008)
Percee P: „Perseverance“ (Stones Throw 2007)
Common: „Finding Forever“ (Geffen/Universal 2007)
Wiley: „Playtime Is Over“ (Ninja Tune/Rough Trade 2007)
Dizzee Rascal: „Maths and English“ (XL Recordings/Indigo 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik