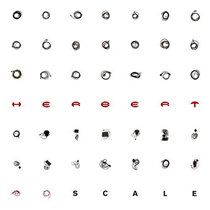An der menschenleeren Küste Dänemarks schrieben Sometree aus Berlin ihr viertes Album „Bending The Willow“. Die neuen Stücke üben einen kraftvollen Sog aus – hinein in die schönste Trübsal

Vor zwei Jahren reiste die Band Sometree nach Dänemark. Man kennt das von Abiturienten: Kaum sind die letzten Prüfungen bestanden, belädt man das Auto mit Menschen, Euphorie und jeder Menge Alkohol und quält die völlig überbeladene Möhre hoch über die Grenze. Dort wird dann ein letztes Mal gemeinsam getrunken, geknutscht, gegrölt und manchmal auch geschwommen. Jedenfalls gefeiert.
Sometree wollten genau das Gegenteil. Gefeiert hatten sie genug, wurden sie genug. Nachdem sie ein Jahr lang Europa bespielt hatten, brauchten sie vor allem eines: Ruhe. Und die fanden sie in einem kleinen Holzhaus an einer menschenleeren Küste. Dort schrieben sie ihr viertes Album Bending The Willow – von freudetrunkenem Party-Rummsgazong ist darauf folglich keine Spur.
Melancholiker waren Sometree schon immer. Sie veröffentlichten drei Alben voller lakonischer, intimer Lieder über die Trias Leben, Liebe und Tod. Spannten Bögen von traurigen, poetischen Schwelgereien zu schroffem, wütendem Rock, von Melantonin zu Adrenalin – das machte sie in Deutschland einzigartig. Musik, die plötzlich loderte, in der Rückkopplungen piepsten und pfiffen, Musik, die einen mitriss, begeisterte und zugleich erhaben traurig war.
Von der Wut der früheren Alben hört man wenig auf Bending The Willow. Sie brodelt nun unter der Oberfläche. Gelegentlich zeigt sie sich, bricht aus in einem kurzen, ruppigen Gitarrenthema, das sich rasch wieder im dräuenden, stellenweise ätherischen Konzept des Albums verliert. Die komplexen Klanglandschaften Sometrees tragen kleine Zornesfalten, mehr nicht.
Schlimm ist das nicht. Bloß ungewohnt – wie die digitalen Elemente in den ausgedehnten Instrumentalpassagen. Keine aufdringliche Elektro-Pfriemelei, sondern Sprachsamples, Rauschen, Surren und Knirschen. Ein wenig klingt das nach der Einsamkeit der Küste, an der das Album entstand. Eine Stimmung, in die sich ein geisterhaftes Klavierlegato ausgezeichnet einpasst – wie im Stück Seraph – und in der selbst eine Trompete nicht stört.
Die Zerrissenheit ist immer noch da. Das Verlorensein, die Sehnsucht, die Verzweiflung des Verlassenen. Doch nun singen sie: „Stop saying Goodbye if you always return!“ Auch der Gesang ist gelassener, trägt nicht mehr diese asthmatische Ergriffenheit mit sich herum wie, naja, früher.
So ist Bending The Willow das intensivste, beste Album von Sometree. Die zehn neuen Stücke entfalten einen kraftvollen Sog hinein in die schönste Trübsal. Einsamkeit und Wärme fügen sich zu einen überzeugenden Stück Rockmusik aus Deutschland.
„Bending The Willow“ von Sometree ist als LP und CD erschienen bei pop-u-loud/PIAS
Hören Sie hier ![]() „Bending The Willow“
„Bending The Willow“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
Kate Mosh: „Breakfast Epiphanies“ (Noisolution 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik