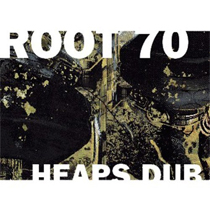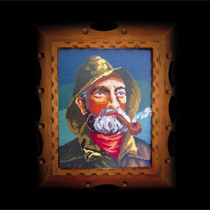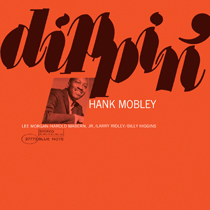Midlake singen bewegende Lieder vom einfachen Leben. Ihr Album „The Trials Of Van Occupanther“ erinnert an den Folk-Rock der späten siebziger Jahre

Was ist das denn? Schon wieder ein neues Album von Fleetwood Mac? Oder sind es Crosby, Stills, Nash & Young? Die Siebziger klingen durch: Ein gehaltvolles Piano und eine schmutzige Rockgitarre geben den Rhythmus vor, dazu kommt melodiöser mehrstimmiger Gesang über Bergsteiger und Steinmetze, Zedernholz und undichte Dächer. Die Stimme allerdings klingt weder nach Neil Young oder Steven Stills noch nach Fleetwoods Stevie Nicks.
Roscoe heißt das berauschende Stück und eröffnet das zweite Album der Band Midlake, The Trials Of Van Occupanther. Ein Album, das in seiner Melodiösität und seiner Direktheit, seiner Instrumentierung und Stimmung an vielen Stellen Erinnerungen weckt. Ein junger Mann namens Tim Smith hat das Album mit seiner Band in seinem Haus in Denton, Texas aufgenommen.
Dem flotten Roscoe folgt Bandits, eine halbakustische Ballade. Vorgetragen ohne Schmalz, verfeinert von einer dezente Flöte, zeigt es die Qualität von Midlake auf: Die Lieder sind getragen, aber nicht pathetisch; sie sind gefühlvoll und beschwingt, aber nicht banal.
Spätestens beim fünften Stück, Young Bride, ist klar, dass die späten Siebziger und der so genannte Adult Oriented Rock ganz und gar nicht die einzigen Bezugspunkte im musikalischen Universum Midlakes sind. Mit jedem Hören fallen mehr schrammelige Brit-Pop-Gitarren, psychedelisches Synthesizer-Gedaddel und andere Störgeräusche auf. Young Bride mit seinem stampfenden Rhythmus könnte mit etwas Glück der Schlüssel zum Erfolg von Midlake werden. Vorausgesetzt, die Indie-Diskos und Radiosender springen auf diesen Ohrwurm an.
Eine Stärke der Band sind die poetischen Texte. In Bandits stellt Smith die Frage, „Did you ever want to be overrun by bandits, to hand over all of your things and start over new“. Und erzählt dann, wie sie ausgeraubt wurden, als sie sich auf der Jagd befanden, wie sie einen Hasen und einen Ochsen fingen, und dass der Raub für sie gar kein Verlust gewesen sei, weil sie mit den beiden Tieren einfach ganz von vorne anfangen konnten. Nie steuern die Texte auf dramatische Enden oder Pointen zu, sie beschreiben das einfache, meist ländliche Leben. Sie erzählen von Wünschen und Träumen – „Bring me a day full of honest work, and a roof that never leaks, I’ll be satisfied“, heißt es in Head Home. In Young Bride ist die eben noch junge Braut plötzlich eine alte Frau, in It Covers The Hillsides geht es um den Kampf gegen den Hunger, wenn der erste Schnee fällt. We Gathered In Spring zieht ein ernüchterndes Fazit unter die Ausweglosigkeit des Landlebens, „I’m tired of being here on the hill, where I’m sure to find my last meal“.
Man könnte das alles als feine Gesellschaftskritik deuten, als Darstellung der Welt jener Menschen, denen Alltag heißt, ums Überleben zu kämpfen. Vielleicht aber wäre das eine Überinterpretation eines Werkes, das ohne Zynismus von der Einfachheit menschlicher Existenz erzählt.
„The Trials Of Van Occupanther“ von Midlake ist als LP und CD erschienen bei Bella Union.
Hören Sie hier ![]() „Young Bride“
„Young Bride“
Bei myspace kann man sich außerdem das Stück „Roscoe“ anhören
..
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Stuart Staples: „Leaving Songs“ (Beggars Banquet 2006)
Nelly Furtado: „Loose“ (Geffen/Universal 2006)
Justine Electra: „Soft Rock“ (City Slang 2006)
Nouvelle Vague: „Bande À Part“ (PIAS 2006)
The Superimposers: „Missing“ (Little League Productions 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik