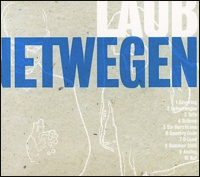Schlagzeug, Gitarre, Bass, mehr brauchen Shellac nicht, um auf „Excellent Italian Greyhound“ gehörig zu rumpeln.
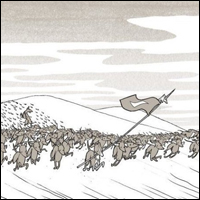
Platten von Shellac klingen, als wäre man im Proberaum dabei. Ihre neue Aufnahme, Excellent Italian Greyhound, mehr als jede zuvor. Ihre Musik ist nicht geschliffen, sie wirkt spontan. Am Anfang des ersten Stücks The End Of Radio fragt der Sänger, „Ist das Ding an? Könnt ihr mich hören?“, so als wäre er sich nicht ganz sicher, ob sie noch proben oder schon aufnehmen. Der Text klingt improvisiert, er wiederholt die Worte und „Test, Test, Test.“ Er grummelt, „I would like to thank the sponsor“. Pause, dann: „But… we haven’t got a sponsor.“
Der Bassist Bob Weston spielt dazu drei langsame, einfache Akkorde, Mal um Mal, achteinhalb Minuten lang. Sein Instrument ist verzerrt und nicht immer ganz im Takt. Der ist stellenweise aber auch schwer auszumachen, der Schlagzeuger Todd Trainer bricht immer wieder aus, setzt aus, drischt, wird schneller und wieder langsamer.
Steady As She Goes rumpelt und bollert, Be Prepared kracht und rumpelt, Boycott bollert und kracht. Alle Stücke klingen karg, wie ein Schlagzeug, eine Gitarre und ein Bass ohne großes Trara eben klingen. Elephant klingt noch karger als der Rest, da spielt minutenlang nur das Schlagzeug. Dann wieder tragen Albini und Weston im Dialog vor, schließlich singen sie eine richtig süße Melodie. Am Anfang staunt man über den aufgenommenen Klang, über die Homogenität der Platte. Bei wiederholtem Hören fällt einem auf, wie unterschiedlich und abwechslungsreich die einzelnen Stücke sind.
Die Band Shellac gibt es seit fünfzehn Jahren, Excellent Italian Greyhound ist ihr viertes Album. Ihr Gitarrist und Sänger ist der bekannte Produzent Steve Albini. An die 2000 Alben hat er bislang aufgenommen, so genau weiß das niemand. Nirvana hat er betreut, die Pixies, PJ Harvey, Mogwai, Fugazi, Joanna Newsom und viele andere bekannte und vollkommen unbekannte Bands. Albini ist der Meinung, jede Gruppe habe das Recht, aufgenommen zu werden.
Er nennt sich nicht producer, sondern recording engineer. In seinem Studio Electrical Audio in Chicago nimmt er so viel wie möglich live auf und verzichtet auf technische Tricks, wie sie heute üblich sind. Wer von ihm aufgenommen wird, muss spielen können und wissen, wie es klingen soll.
Wie sich Shellac nun anhören, fragen Sie? Diesem Text ein Hörbeispiel zur Seite zu stellen verbietet Mister Albini leider, auch Rezensionsexemplare gibt es von Shellac nicht. Aber man kann sich Shellac im Web 2.0 anschauen, bei YouTube zum Beispiel. Dort gibt es eine Mobiltelefonaufnahme von The End Of Radio vom Primavera-Festival des Jahres 2006. Albini improvisiert die Stelle mit dem Dank an den Sponsor auf dieser Aufnahme, er bittet Martina Navratilova, ihr Sponsor sein zu dürfen, „your name is fun to say, Martina Navratilova“. Beim ebenso auf YouTube einsehbaren Musikvideo zu Steady As She Goes laufen Bild und Ton nicht synchron, sie sind um genau einen Takt verschoben, dadurch fällt es kaum auf. Die drei Musiker stehen in einem kleinen Raum, es scheppert und rumpelt. Exakt so klingen Shellac auf Platte.
„Excellent Italian Greyhound“ von Shellac ist erschienen bei Touch & Go/Soulfood Music
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
Editors: „An End Has A Start“ (PIAS/Rough Trade 2007)
Tomahawk: „Anonymous“ (Ipecac 2007)
Battles: „Mirrored“ (Warp/Rough Trade 2007)
Arctic Monkeys: „Favourite Worst Nightmare“ (Domino 2007)
Dinosaur Jr.: „Beyond“ (PIAS 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik