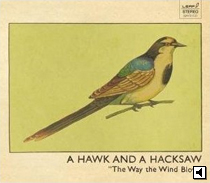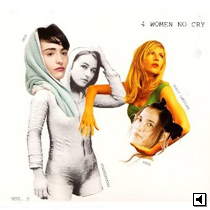Sie singt mit der Zunge in der Backe. Sie schreit, sie jault, auf Englisch, auf Japanisch. Sie ist Yoko Ono. Und dies ist ihre neue Platte.
Sie kann machen, was sie will. Bis an ihr Lebensende und darüber hinaus wird sie die Frau sein, die den Beatles John Lennon nahm. Von der es heißt: Ach, ja, Musik hat sie auch gemacht. Aber Yoko wäre nicht Ono, würde sie nicht immer wieder versuchen, diesem Schicksal zu entfliehen. Diesmal versucht sie es mit einem Bekenntnis: Yes, I’m A Witch – Ja, ich bin eine Hexe.
Sechzehn ihrer alten Lieder hat sie neu aufgenommen, mit Musikern der Independent-Szene. Es ist kein zweifelhafter Künstler dabei, außer vielleicht ihr. Aber ein Erfolg sei Yoko Ono gegönnt, denn so schlecht wie ihr Ruf war ihre Musik nie. Früher standen ihre schrillen Kompositionen in einem interessanten Gegensatz zu John Lennons verträumten Friedensliedern. Viele der nun eingespielten Stücke stammen aus den Jahren zwischen 1969 und 1980, sind also zu einer Zeit entstanden, da sie mit ihm Bett und Studio teilte. Von einer Ausnahme abgesehen hat sie alle geschrieben.
Die meisten der beteiligten Musiker dürften sie gar nicht zu Gesicht bekommen haben. Ihnen wurden die Bänder mit ihrer Stimme zur Verfügung gestellt, sie spielten dann die Musik dazu, wie, blieb ihnen überlassen. In den meisten Fällen fügt sich Onos Stimme hervorragend ein.
In den Siebzigern hieß es oft, sie sei ihrer Zeit voraus; so musste man sich mit ihrer Kunst nicht groß auseinandersetzen. Und nun? Rock ist dabei und Drum’n’Bass, Tanzbares und Schmalziges – eine krude Mischung. Die englische Band Spiritualized nimmt sich das Stück Walking On Thin Ice vor und macht eine laute Hymne daraus. Die Gitarren heulen, die Orgel dröhnt, das Schlagzeug poltert, Bedeutung kracht durch die Luft. Angeblich hielt John Lennon eine Kassette mit der Originalaufnahme in den Händen, als er im Dezember 1980 in New York vor seinem Haus erschossen wurde.
Auch Toyboat klingt wichtig, Yoko schrieb es kurz nach Johns Tod: “I’m waiting for a boat to help me out of here.“ Antony – der von den Johnsons, hier aber ohne sie – lässt es die schmalzige Ballade sein, die es im Original schon war, legt allerdings einen sehr, sehr billigen Keyboardrhythmus und esoterische Gesänge drunter. Ihm gelingt das Kunststück, ein mittelmäßiges Lied richtig schlecht zu machen.
Bei aller Zerrissenheit des Albums sind viele der Stücke für sich genommen gar nicht übel. Peaches’ flirrende Tanznummer Kiss Kiss Kiss und Le Tigres schleppendes Sister O Sister sind sogar ziemlich großartig. Da passt alles zusammen, proletarische Rhythmen, dicker Bass, exaltierte Stimme, hier und da sogar Schreie.
Durchgängige Begeisterung kommt jedoch nicht auf. Das Konzept krankt daran, dass die Auswahl der Künstler lieblos wirkt. Die Tanzbässe von Peaches und Le Tigre passen nicht zum Elektrorock von The Brother Brothers und Blow Up, die sanften Klaviertöne der Cat Power nicht zu den triefigen Balladen des Craig Armstrong. Spiritualized und The Flaming Lips ertränken Yoko Onos Stimme in klirrendem Gitarrenlärm, Hank Shocklee von Public Enemy lässt sie zu hektischem Drum’n’Bass verkünden: „Ich bin eine Hexe, ich bin eine Hure, ist mir doch egal, wie ihr das findet!“
Eine Doppel-LP mit nach Genres sortierten Seiten hätte sich für ein solch zerfahrenes Projekt angeboten. Doch weder gibt es Yes, I’m A Witch vollständig auf Vinyl, noch wäre Ordnung im Sinne der Künstlerin gewesen. So muss der Hörer seinen CD-Player selbst programmieren. Lust zu tanzen? Dann bietet sich die Reihenfolge 1, 2, 4, 5, 16 an. Drückt das Herz? Die Stücke 6, 8, 10 und 13 trösten. Harmlose Popliedchen? 3, 7, 11, 15. Die Welt im Gitarrenlärm vergessen? 12 und 14, auf Dauerwiederholung stellen.
Die Stücke 9 und 17 hört man am besten gar nicht.
„Yes, I’m A Witch“ von Yoko Ono ist als CD erschienen bei Astralwerks/Virgin. Einzelne Stücke gibt es auf limitierten Vinylmaxis.
Hören Sie hier Ausschnitte aus
![]() „Kiss Kiss Kiss“ von Yoko Ono und Peaches,
„Kiss Kiss Kiss“ von Yoko Ono und Peaches,
![]() „Cambridge 1969/2007“ von Yoko Ono und The Flaming Lips,
„Cambridge 1969/2007“ von Yoko Ono und The Flaming Lips,
![]() „Revelations“ von Yoko Ono und Cat Power,
„Revelations“ von Yoko Ono und Cat Power,
![]() „Yes, I’m A Witch“ von Yoko Ono und The Brother Brothers
„Yes, I’m A Witch“ von Yoko Ono und The Brother Brothers
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Tokio Hotel: „Zimmer 483“ (Universal 2007)
Two Birds At Swim: „Returning To The Scene Of The Crime“ (Green Ufos 2007)
Kim Frank: „Hellblau“ (Universal 2007)
Jamie T: „Panic Prevention“ (EMI/Labels 2007)
Monta: „The Brilliant Masses“ (Labelmate/Klein 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik