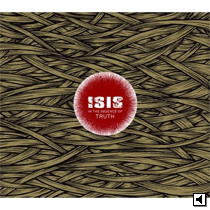Isis aus Los Angeles lieben die Melodien, die Anspielungen und die Abwechslung. Leider wird auf „In the Absence Of Truth“ zu viel gebrüllt
Ein paar Sekunden ist nichts zu hören, dann erhebt sich eine sanfte Harmonie. Ein Schlagzeug bollert hinein in düstere Flächen aus synthetischen Klängen. Hallbelegte Töne der elektrischen Gitarre tauchen auf, wie kleine Lichtblitze im Nebel. Das Schlagzeug wird hektisch, doch das scheint nur so.
Immer lauter grummelt der Bass aus dem Hintergrund nach vorne, der Synthesizernebel verdichtet sich. Minutenlang fügen Isis Schicht um Schicht hinzu, ein Brei entsteht. Im dichten Gedränge der Klänge kaum mehr wahrnehmbare Disharmonien schleichen sich ein, ganz so, als würde eine Explosion vorbereitet.
Wieder falsch. Nach einer Ewigkeit halten sie inne, entrümpeln das Stück. Der Takt wird gewechselt, die Tonart, die Stimmung. Aaron Turner singt langgezogene Worte in den frisch gewaschenen Klangteppich. Seine Stimme kommt von hinten, eine schöne Melodie. Die Harmonien erinnern an den Rock der siebziger Jahre und an Marillion und Porcupine Tree.
Später wird die Gitarre dann nachdrücklich, Aaron Turner singt sich hoch ins Hymnische. Der Bass grunzt Heavy-Metal-Muster. Plötzlich rutscht die Stimme anderthalb Oktaven ab und ist nur noch als kehliges Geschrei zu vernehmen. „Die!“ – Stirb! kann das nur heißen, was einem da entgegengebrüllt wird. Auch wenn man ihn die ganze Zeit eigentlich erwartet hat, so recht passen mag der plötzliche Ausbruch nicht in das kaum aggressive Wrist Of Kings.
So ähnlich ist es bei fast jedem Stück auf Isis‘ viertem Album In The Absence Of Truth. Die Musik ist eher sphärisch als hart, die Gitarren und der gedroschene Bass treten nur selten aus dem Klangnebel hervor. Die Stimme ist meist leise, das Schlagzeug trocken und hallfrei. Früher oder später packt es den Sänger dann aber, und er zerbrüllt die ansonsten so melodiösen Klanggebilde mit unverständlicher Lyrik. Zu schade!
Wenn man sich Mühe gibt, kann man es ignorieren. Man sollte es tun, denn die Stücke stecken voller Ideen und Referenzen. Not In Rivers, But In Drops macht Anleihen bei The Cures düsterem Album Pornography, der Bass scheppert böse. Da wirkt eine Kraft, die ohne stählerne Härte auskommt, die auch ohne Lautstärke funktioniert und ohne kreischende Instrumente, die in den Vordergrund drängen. Over Root And Thorn baut auf einem sich für achteinhalb Minuten stetig wiederholenden Gitarrenmuster auf, langsam, düster und melodiös. Aber nie langweilig. Und aus der Selbstversunkenheit von Holy Tears hört man Pink Floyd heraus.
Parallel zu In The Absence Of Truth erscheint ein Minialbum für die In The Fishtank-Serie des niederländischen Labels Konkurrent. Zu hören sind drei Stücke, die Isis gemeinsam mit der schottischen Band Aerogramme aufgenommen haben. Da wird nicht gebrüllt.
„In The Absence Of Truth“ von Isis ist als CD erschienen bei Ipecac und wird als Doppel-LP Ende Januar bei Robotic Empire erscheinen
Hören Sie hier ![]() „Dulcinea“
„Dulcinea“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
Mouse On Mars: „Varcharz“ (Ipecac/Sonig 2006)
Sid Le Rock: „Keep It Simple, Stupid“ (Ladomat 2006)
Early Day Miners: „Deserter“ (Secretly Canadian 2006)
Can: „Tago Mago“ (Spoon Records 1971)
Cursive: „Happy Hollow“ (Saddle Creek 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik