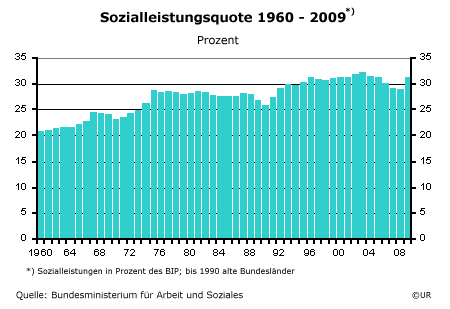Ich kann die Begeisterung der deutschen Presse über das geplante Reprofiling der griechischen Staatsschulden – zum Beispiel in der FTD oder in der Süddeutschen – nicht nachvollziehen. Eine Verlängerung der Anleihelaufzeiten ist zumindest aus Sicht der Ratingagenturen wohl ein Kreditereignis (wenn es auch keine CDS-Kontrakte auslösen dürfte). Denn die Investoren erhalten nicht zum vereinbarten Zeitpunkt das vereinbarte Geld. Europa fängt sich also das ganze Bündel von Risiken ein, das mit einem solchen Ereignis verbunden ist, insbesondere die Gefahr der Ansteckung anderer Staaten.
Mehr noch: Erneut schiebt die Politik Risiken auf die Bilanz der Europäische Zentralbank. Denn die EZB akzeptiert, wie es sich für eine Zentralbank gehört, griechische Staatsanleihen als Sicherheit bei ihren Refinanzierungsgeschäften. Die Notenbank müsste also wenn Griechenland umschuldet die Mindestanforderungen an die Sicherheiten noch weiter aufweichen. Damit würde sie wohl endgültig ihr Mandat überschreiten und sich noch weiter in Richtung monetäre Staatsfinanzierung begeben. Eine Zentralbank ist dazu da, Liquidität bereitzustellen. Es ist nicht ihre Aufgabe, Solvenzprobleme zu lösen, das kann nur die Finanzpolitik.
Wenn die EZB die Anleihen aber nicht mehr annähme, würde sie Griechenland de facto von der Refinanzierung abzuschneiden – mit gravierenden Folgen für die griechischen Banken. Und wenn die Anleihen eines Mitgliedsstaat einer Währungsunion nicht einmal mehr von der eigenen Zentralbank akzeptiert werden, kann man den Euro auch gleich abschaffen, beziehungsweise den Griechen den Austritt nahelegen.
Eine Umschuldung light ist also mit erheblichen Kosten verbunden – und sie bringt wenig. Wenn die griechischen Schulden jetzt nicht tragfähig sind, dann sind sie es natürlich auch nicht, wenn die Laufzeiten der Anleihen um fünf Jahre verlängert werden. Genau so sehen das die Finanzmärkte und deshalb tut sich bei den griechischen Spreads wenig.
Freuen wird sich allein Frank Schäffler von der FDP, der jetzt überall erzählen kann, er habe die Beteiligung der Gläubiger durchgesetzt. Es ist wirklich dramatisch, wie wenig Ahnung eine Wirtschaftspartei von Wirtschaft hat. Die einzige Logik der Umschuldung light ist eine politische – sie sichert möglicherweise die Zustimmung des Bundestag, falls ein neues Rettungspaket nötig wird. Es ist traurig, dass unter den Abgeordneten heutzutage Symbolpolitik mehr zählt als Sachargumente. Vielleicht war das mit der Philosophenherrschaft doch keine so schlechte Idee.
Ganz oder gar nicht, so kann die Lösung nur heißen. Entweder Griechenland wird zum Bankrottfall erklärt und so umgeschuldet, dass es als solvent gelten kann. Das bedeutet ein Schuldenschnitt in der Größenordnung von 50 bis 70 Prozent und ein neues Hilfspaket, um die Banken in Griechenland und im Rest Europas zu sanieren. Das wäre riskant, aber immerhin wäre das Problem dann gelöst. Oder die EU setzt darauf, dass Griechenland solvent bleiben kann. Durch zusätzliche Anstrengungen der Griechen niedrigere Zinsen, neue Hilfspaket – und ja: Transfers.
Auf die Hoffnungen des IWF auf enorme Privatisierungserlöse sollte man dabei wenig geben. Entweder ein Unternehmen im Staatsbesitz ist rentabel, dann generiert es Erträge und die Privatisierung bringt den Staat um die zukünftigen Erträge. Oder es ist Schrott, aber dann wird sich auch kein vernünftiger Preis erzielen lassen. Wie immer ist der Barwert entscheidend – das sollten die IWF-Ökonomen eigentlich wissen.