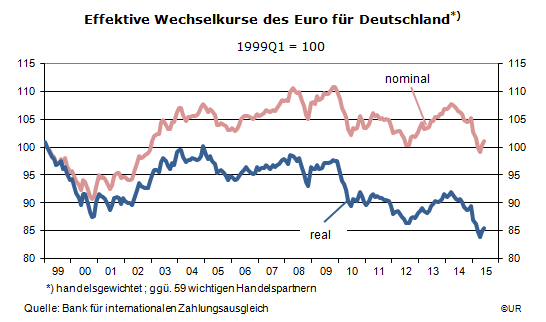Der Rückgang der Rohstoffpreise, insbesondere von Erdöl, – um 40 bis 60 Prozent seit ihrem letzten Hoch – hat die internationale Einkommenssituation stark verändert. Während die Produzenten und Exporteure nur noch die Hälfte dessen einnehmen, an was sie sich gerne gewöhnt hätten, können sich Nettoimporteure wie China, Japan, die Europäische Währungsunion oder Indien über kräftige Kaufkraftgewinne freuen, vergleichbar einer Steuersenkung, die nicht mit einem erhöhten staatlichen Defizit einhergeht. Bei den Einen schwächt sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ab, bei den Anderen wird sie stimuliert.
Russland ist von den größeren Ländern am meisten betroffen. Weil es im Vierteljahrhundert seit dem Ende des Kommunismus nicht gelungen ist, die Produktion, die Exporte und die Aktienmärkte auf eine breitere Basis zu stellen, ist seine Wirtschaft immer noch stark vom Auf und Ab der Rohstoffpreise abhängig. Der Rubel hat sich in kurzer Zeit um mehr als die Hälfte abgewertet, und das reale BIP dürfte in diesem Jahr gegenüber 2014 um etwa vier Prozent zurückgehen. Russische Aktien sind billig auf der Basis des KGV, aber das sind sie fast immer. Eine Dividendenrendite von 4,7 Prozent ist niedrig angesichts einer Inflationsrate von fast 16 Prozent.
China ist sowohl der wichtigste Importeur von Rohstoffen als auch der größte Profiteur ihres Preiseinbruchs. Da es mit der Wirtschaft zuletzt nicht mehr so gut lief, vermutlich weil es im Wohnungsbau und im Bereich Infrastruktur Überinvestitionen gegeben hatte, war seine Nachfrage nach Erdöl, Eisenerz und anderen Metallen stark zurückgegangen und hatte deren Preissturz ausgelöst. Die Fundamentaldaten des Landes sind nach wie vor sehr robust, so dass die Wirtschaft vermutlich positiv auf den Politikschwenk in Richtung Expansion reagieren wird. Das größte Risiko ist die hohe Verschuldung des privaten Sektors: Durch den Verfall von Immobilienpreisen und Aktienkursen könnten weite Teile der Bevölkerung finanziell unter Wasser geraten sein und sind daher gezwungen, ihre Ausgaben einzuschränken. Es könnte zu einem „deleveraging“ à la Japan kommen.
Das ist aber nicht mein Hauptszenarium. Ich denke vielmehr, dass sich China fangen wird. Zusammen mit dem beschleunigten Wachstum in den USA und Westeuropa wird das zu einer Stabilisierung der Nachfrage nach Rohstoffen führen und deren Preisverfall stoppen. Dennoch sind kurzfristig weitere Rückgänge möglich.
Insgesamt haben sich die Deflationsrisiken in den reichen Ländern durch die Probleme in den Schwellenländern und bei den Produzenten von Rohstoffen erhöht. Sowohl die aktuellen Inflationsraten als auch die Inflationserwartungen sind erneut auf dem Rückzug und zwingen die Notenbanken, ihren expansiven Kurs, also die niedrigen Leitzinsen und die großzügige Liquiditätsversorgung, beizubehalten. Das gilt selbst für die USA. Für die Bondmärkte ist das eine positive Nachricht (wenn auch nicht für die Sparer) – sie sind gut abgesichert.
Die Korrektur der europäischen und amerikanischen Aktienmärkte ist bisher recht moderat ausgefallen. Von einem Ausverkauf kann keine Rede sein. Von den immer noch hohen Bewertungen her würde es nicht überraschen, wenn die Kurse weiter fallen würden. Andererseits läuft die Konjunktur nicht zuletzt wegen der Kaufkraftgeschenke seitens der Rohstoffproduzenten etwas besser als erwartet. Euroland kommt zudem zugute, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen durch den schwachen Wechselkurs verbessert hat.
Ausführliches zu den Effekten der gefallenen Rohstoffpreise auf die Ökonomien der Industrie- und Schwellenländer, und den Aussichten und Risiken für Aktien, Bonds und Rohstoffe finden Sie in meinem neusten Investment Outlook:
Wermuth’s Investment Outlook – Commodity crash: importers win, producers lose, September 2015*) (pdf, 655 KB)
*) Der Investment Outlook von Dieter Wermuth ist in englischer Sprache verfasst und wird im Herdentrieb in loser Folge zum Herunterladen bereitgestellt. (UR)