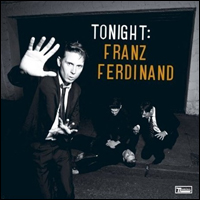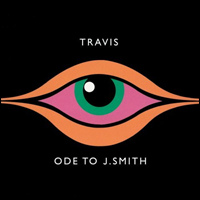„Intimacy“ nennen Bloc Party ihr drittes Album. Doch von wegen Kuschelrock: Brachial wälzt sich ein elektronisches Klangmonster aus den Lautsprechern. Viele Fans dürften sich die Ohren reiben
Der Virenscanner schlägt stillen Alarm, ein kleines Fenster blinkt mich an. „Im Verzeichnis /Eigene Musik/IndieRock/BlocParty/Intimacy ist das trojanische Pferd TR/snthsnd.98 enthalten. Quarantäne, Ignorieren oder Löschen?“
Dabei sah alles so gut aus. Die englische Band Bloc Party gibt im Jahr 2008 kein einziges Interview, reist um die Welt und stellt im August mal eben ihr neues Album für siebeneinhalb Britische Pfund ins Netz. Erstmal keine CD, keine Platte, kein Vertrieb, nur Daten. So funktioniert die moderne Musikwelt, ist das noch eine Erwähnung wert?
„Sind das noch Bloc Party?“, fragte man sich schon angesichts der Vorabsingle Mercury im Sommer. Da dröhnen die Bläser wie bei James Bond neben elektronischem Hack, das Stück hat keinen richtigen Refrain und ist weit entfernt von den ursprünglichen Klängen der Band. Weniger Rock, mehr Elektronik, das ist nicht ohne Risiko in einem Geschäft, das zum großen Teil von Konzerteinnahmen lebt.
Der Virenscanner wartet auf eine Entscheidung. Kurzes Nachsehen im Netz bestätigt: Der Download ist in Ordnung, die Kategorisierung macht Probleme. Bleibt nur, die heuristische Erkennung auszuschalten und sich selbst ein Bild zu machen. Also, „Ignorieren“ und los:
„I want to declare a war“ brüllt Ares, der Gott des Blutbads. Kurz blitzt die Unsicherheit wieder auf: Wenn doch was kaputt geht? Moment, darum geht es ja, um die Rohheit der Straße, ums Kämpfen. Dizzee Rascal könnte da noch mehr erzählen, aber der rappt woanders. Gegen Ende hält der Sänger Kele Okereke kurz Inne und wundert sich, dass die nasebrechenden Hände mit ihren Berührungen auch Wunder bewirken könnten. Drum heißt das Album wohl Intimacy.
Intimacy? Die Platte ist kein Kuschelrock, soviel ist schnell klar. Brachial und ausproduziert wälzt sich ein Klangmonster aus den Lautsprechern. Bei Biko blickt es über den Fluss Styx – und stellt fest, dass die Welt nicht nett ist zu den kleinen Dingen. Hier singt Okereke, dass man nicht allein sei, dort wünscht er sich zurück in eine gute Zeit. Am Ende ist alles Trugschluss, ein leeres trojanisches Pferd. Kaum hat man sich damit abgefunden, machen die hellen Glocken und der technoid treibende Rhythmus von Signs die Verzweiflung ertragbar. Ist das der Ausweg?
One Month Off klingt, als solle es die langjährigen Anhänger mit dem Album versöhnen, trotz der vielen Computerspielgeräusche. Zephyrus stößt ihnen gleich wieder vor den Kopf, der Gott des Westwindes weht uns zum Ausgangspunkt zurück. Die Melange aus elektronischen Chören, lamentierendem Gesang und angezerrtem elektronischen Schlagzeug ist immerhin so ambitioniert, dass man nicht gleich weiterdrückt.
Und schließlich verteilen Bloc Party dann die Belohnung. Wer bis zu Stück Nummer 9 ausgeharrt hat, bekommt Better Than Heaven, Talons und Ion Square zu hören – da hat die Band ihren Markenzeichenklang ins Jahr 2008 übertragen. Ion Square setzt den Schlusspunkt des Albums, es ist eine treibende Nummer, die mit melancholischer Leichtigkeit und warmen Synthesizer-Arpeggien recht versöhnlich klingt. Kele Okereke richtet ein warmes Schlusswort an die Hörer. Bei all dem Schmerz, der die Band bis hierhin trieb, ist „I carry your heart here with me, I carry it in my heart“, eine der intimsten Zeilen des Albums.
Plötzlich wird klar, dass der Virenscanner zurecht warnte. Jetzt ist es zu spät, das trojanische Pferd ist längst da und wird nicht mehr gehen. Der Titel hatte es ja angekündigt, wer Intimität möchte, der muss ein paar Schranken öffnen. Intimacy kann sich nur annähren, wer ein kleines Risiko eingeht.
Wem der Download zu riskant ist oder zu wenig betastbar, der kann dieser Tage das Album schließlich als klassischen Tonträger erstehen – und bekommt sogar noch zwei Stücke obendrauf.
„Intimacy“ von Bloc Party ist als CD und LP bei Cooperative/Universal erschienen.
Wer Bloc Party im Interview hören möchte, klicke am Freitag, dem 31. 10., um 22 Uhr das Netzradio ByteFM an. Michael Seifert widmet der Band seine zweistündige Sendung „Almost Famous“.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
Travis: „Ode To J. Smith“ (Vertigo/Universal 2008)
Oasis: „Dig Out Your Soul“ (Big Brother/Indigo 2008)
Kings Of Leon: „Only By The Night“ (Sony BMG 2008)
Mogwai: „The Hawk Is Howling“ (Wall Of Sound/Rough Trade 2008)
The Sisters Of Mercy: „First And Last And Always“ (WEA 1985)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik