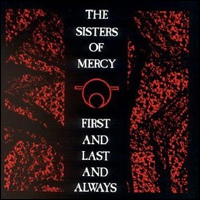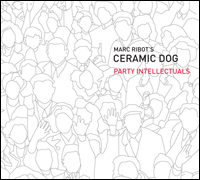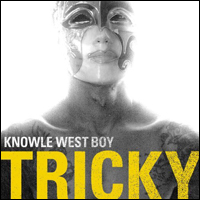Der Weißkopfseeadler ist der größte Greifvogel Nordamerikas. Seine Flügel umspannen im Flug zweieinhalb Meter Luft, im Sitzen ist er so groß wie ein Erstklässler. Der Mensch hat ihn durch das Insektizid DDT in den Fünfzigern fast ausgerottet, heute lebt der Vogel vor allem in Alaska, Florida und Kanada. Er ziert das Wappen der Vereinigten Staaten – einen Olivenzweig in der linken Kralle, ein Bündel Pfeile in der rechten und im Schnabel ein Band mit den Worten E pluribus unum, aus vielen Eines. Bald Eagle heißt er übrigens auf englisch, kahler Adler.
Mogwai kommen aus Glasgow, sie spielen Rock. Ein Weißkopfseeadler ist auf die Hülle ihres neuen Albums The Hawk Is Howling gemalt. Ein rätselhafter Titel, schließlich ist ein Hawk ja ein Falke und kein Adler. Und heulen Falken? Heulen Adler? Das Rätsel muss Rätsel bleiben, denn Mogwai spielen ihren Rock ohne Worte. Und irgendwie passt der Adler doch, das majestätische Gleiten eines Riesengreifs kann man sich zu ihrer hymnischen Musik wirklich gut vorstellen.
Federvieh steckt auch hinter dem Namen der Band, eine unansehnliche Kreatur in dem Film Gremlins trug ihn im Jahr 1984. Mogwai ist außerdem das kantonesische Wort für Geist. Das habe alles gar keine Bedeutung, sagte der Gitarrist Stuart Braithwaite einmal, der Band sei einfach kein besserer Name eingefallen. Die Musiker hätten sich vorgenommen, irgendwann einen besseren Namen zu suchen, seien aber bislang nicht dazu gekommen.
Das ergäbe nun wohl auch keinen Sinn mehr, schließlich haben Mogwai bereits sechs, sieben Alben aufgenommen und es zu einer gewissen Bekanntheit gebracht. Außer Prince kann sich wohl niemand spontane Umbenennungen leisten.
Auch das ist rätselhaft: Wie kommt man eigentlich auf einen Titel, wenn man nicht singt? Das erste Stück auf The Hawk Is Howling heißt I’m Jim Morrison, I’m Dead. Warum I am? Und klar, Morrison ist tot. Hat die Band hier die Autobiografie des Sängers vertont? 27 Jahre in 6 Minuten 46? Zu Beginn klimpern ein paar verträumte Klavierklänge (Morrisons Kindheit), dann scheppert das Schlagzeug einen verschlafenen Takt (der im Alter von 4 Jahren beobachtete Autounfall), schließlich mischen ein paar handfeste Gitarrenakkorde mit (Studium der Filmwissenschaft). Im Mittelteil wird es hymnisch und stetig lauter (Liebe, Drogenerfahrungen und Vietnamkrieg), das Ende des Stücks zerquietscht kurz und heftig (Ruhm und Tod). Man kann sich in der Deutung der Zusammenhänge von Titel und Klängen einiges einfallen lassen. Mogwai werden den Teufel tun und sich dazu äußern.
Zwei andere Stücke heißen The Sun Smells Too Loud und Thank You Space Expert. Wie bitte? Die Mogwai in der Stimmung ähnliche amerikanische Band Tortoise taufte eines ihrer Instrumentalstücke vor Jahren A Simple Way To Go Faster Than Light That Does Not Work. Bedeuten die Titel also eigentlich – gar nichts?
Das letzte Album von Mogwai war eine Filmmusik, da war die Entschlüsselung einfacher. In Zidane: Un Portrait Du 21e Siècle richtet die Kamera ihren Blick für 90 Minuten auf Zinedine Zidanes Weg über das Fußballfeld in einem völlig unbedeutenden Spiel. Mogwai unterlegten die Bilder mit epischen Klängen – ohne die Musik wäre der Film langweilig, mit ihnen ist er hübsch.
Episch geht es auf The Hawk Is Howling zwar doch meist, aber nicht immer zu. Die Single Batcat etwa ist ein massiver Brecher von schlecht gelauntem Gitarrenhin- und hergekoppel. Und angesichts der poppigen Melodie von The Sun Smells Too Loud gackert eher ein Perlhuhn, als dass ein Adler gleitet. [Das von einem Fan geschnittene Musikvideo ist einen Blick wert, es passt wirklich gut.] Aus vielen Eines ist gar keine schlechte Beschreibung der Musik von Mogwai auf dieser Platte.
Vor einem Jahr wurde übrigens der Weißkopfseeadler von der Liste der gefährdeten Tiere gestrichen.
„The Hawk Is Howling“ von Mogwai ist als CD und Doppel-LP bei Wall Of Sound/Rough Trade erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
The Sisters Of Mercy: „First And Last And Always“ (WEA 1985)
Kitty, Daisy & Lewis: „s/t“ (Sunday Best/Rough Trade 2008)
Kamerakino: „Munich Me Mata“ (New!Records 2008)
Wire: „Object 47“ (Pink Flag/Cargo 2008)
Marc Ribot’s Ceramic Dog: „Party Intellectuals“ (Yellowbird/Soulfood Music 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik