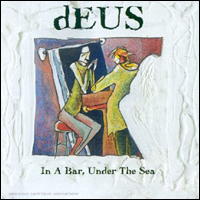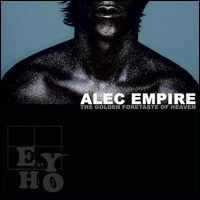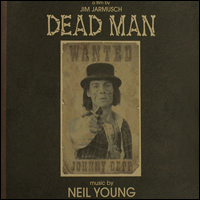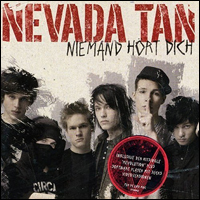Der Deutschen Lieblingsinsel? Rügen. Aber wer besingt schon Rügen. Der deutschen Musiker Lieblingsinsel ist Sylt. Gleich hinterm Hindenburgdamm fanden Reinhard Mey und Die Ärzte ihr Glück – oder zumindest manchen Erfolg. Nun also nennen Kettcar ihr neues Album nach der größten hiesigen Nordseeinsel.
Stellen wir uns vor, wir seien nie auf Sylt gewesen. Wir wüssten nur, was über die Schickeria und das Strandleben in den bunten Blättern steht. Theodor Storm? Nie gehört. Wie würden wir uns wohl eine Platte vorstellen, die den Namen des einzigen gemeinsamen Vororts von Berlin und Hamburg trägt? „Das alles ist so was von langweilig“, befindet der Sänger Marcus Wiebusch. Meint er Sylt? Oder Sylt?
Kettcar sind ein Phänomen. Zusammen mit den Hamburger Kollegen von Tomte bissen sie sich durch schlechte Zeiten ohne Plattenvertrag, Konzert um Konzert. Auf der klassischen Ochsentour erspielten sie sich Anhänger. Deren Schar war bald so groß, dass Talentsucher und Kritiker ihre Ohren nicht länger verschließen konnten.
Im Jahr 2002 erschien Kettcars erstes Album Du und wieviel von deinen Freunden, elf rockige Lieder mit rotzigen deutschen Texten. Nicht Punk, nicht Pop, irgendwas dazwischen. Auch Kettcar durften ein bisschen mitschwimmen auf der Erfolgswelle deutschsprachiger Poprockmusik. Im Jahr 2005 folgte das zweite Album, Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen. Das Freche wich dem Schmalzigen. Mit Sylt nun weicht auch der letzte Rest Originalität dem Einheitsbrei. Wie gehabt streuen sie kleine Sprachspielereien und englische Halbsätze in ihre bodenständige Musik. Und gleich hinter der Textdünung rauscht der mal laut geschrabbelte, mal leise gezupfte Gitarrenklangteppich. Die meisten Lieder klingen, als würden Kettcar sich selbst covern.
Auf Sylt gibt es Leuchttürme. Auf Sylt leider nicht. Kettcar haben den Klangteppich glattgebürstet, eine träge Masse quillt aus den Lautsprechern. So klingt fürs Formatradio produzierter Deutschrock. Die Texte sind nicht schlecht, aber bemüht. Sie berühren den Hörer ebenso wenig wie die Musik.
Anhänger der Band werden das alles wohl schätzen und ihren nächsten Urlaub auf Sylt verbringen. Der Kritiker aber langweilt sich und fährt lieber nach – Rügen.
„Sylt“ von Kettcar ist auf CD und LP erschienen bei Grand Hotel van Cleef/Indigo.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
The Sonics: „Here Are The Sonics!!!“ (Etiquette Records 1965)
Mondo Fumatore: „The Hand“ (Rewika 2008)
dEUS: „In A Bar, Under The Sea“ (Island/Universal 1996)
Bauhaus: „Go Away White“ (Cooking Vinyl/Indigo 2008)
Nada Surf: „Lucky“ (City Slang 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik