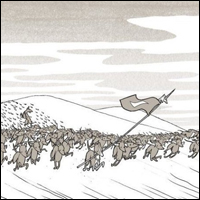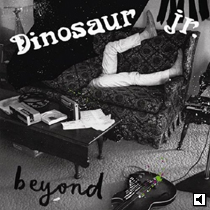Sonntag. Auch nicht immer schön. Draußen rauscht der Herbst heran, der Wind rüttelt an Fenstern, Regen trommelfeuert aufs Dach. Die Tage sind kürzer und die Nächte kälter. Man liegt im Bett schweren Mutes und Kopfes und wünscht sich, jemand möge endlich den intravenösen Bali-Urlaub erfinden und das sofort. Drumherum bläht sich das Leben auf. Sieht finster aus: Der Kaffee ist alle, die Heizung steht auf drei, statt Tatort Kommunalwahl, und wo ist das ganze Geld geblieben? Und, schrecklassnach, mit wem ist eigentlich die Liebste gestern abend abgezogen? Schnell die Bettdecke über den Kopf. Doch zuvor zum Plattenspieler.
Denn es gibt sie, die entsprechende Musik zu solchen Momenten. Das Trio, das sie spielt, kommt aus New York und könnte nicht besser heißen: Codeine. Wie das Schmerzmittel. Nur rezeptfrei. Auf dem Beipackzettel sollte stehen: Bitte alleine hören, bittebitte in moderater Dosierung und bittebittebitte niemals in glücklichen Augenblicken einnehmen. Das geht schief. Am Schluss folgender Nachsatz: „Die Platte gehört so, also Finger weg vom 45-Knopf!“
Sie sind wirklich bedächtig, gemächlich, kriechend, säumig, schläfrig, schleichend, schleppend, stockend, tranig, zäh, zaudernd, zögernd. Auf diese Weise bremsten Codeine den Rock, der ehedem besinnungslos im Grunge taumelte. Das war 1991. Sie schafften nur zwei Alben. Nach ihnen kamen Bands wie Slint, Low oder June of 44. Die Stücke auf Codeines letztem Album The White Birch aus dem Jahr 1994 sind nicht bloß ein paar Rocknummern in Zeitlupe, sondern wohl durchdachte Spiele mit der Weitläufigkeit.
Ihre Kompositionen sind luftig, oft vergeht viel Zeit zwischen einem Snare-Schlag, einem zart gestrichenen Becken, einem Akkord. Dazwischen brummt der Bass von Stephen Immerwahr. Er singt. So bedächtig die Töne inszeniert sind, so sparsam ist er auch mit Worten. Keine Liedtexte, eher Textminiaturen. Das Siebenminutenlied Sea besteht aus acht Sätzen, die Immerwahrs nasale Stimme singt, die immer etwas beiläufig klingt – man möchte beinahe sagen: resigniert. Als quäle auch ihn ein Brummschädel. Er dehnt sie, die Silben, oft über einen ganzen Takt, eine Ewigkeit, hinein in den Nachklang des Schlagzeugs und der Gitarre, die mal wieder pausiert.
Aufmunternde Worte findet er nicht. Nur Ernüchterung. „Now things taste kind of bitter. Two muddy shoes far from home, far from home“, singt Immerwahr im schütteren Loss Leader. „Can’t watch the trees, can’t go outside, don’t go outside“, heißt es in Ides. Der Hörer steckt den Kopf kurz heraus aus der Bettdecke und denkt: Ich auch nicht.
Die Uhr tickt, die Platte knistert, und trotzdem steht die Zeit. Es knallt die Snare, der Bass schnarrt, die Gitarre schallt. In Moll trottet das Trio durch neun Lieder. Gesenkten Blicks. Immer? Fast. Denn plötzlich schäumen sich die Töne auf, raus aus dem Standgas, der Verzerrer wird zugeschaltet, das Becken schneidet, da brandet etwas hoch, lauter wird’s, fast zornig, gleich platzt es, da geht was zu Bruch, kommt die Katharsis, der erlösende Refrain, das Pathos, Schalala-Dur, jetzt, jeeeetzt, jeeeeeeetzt – und:
Pffffff. Alles angetäuscht. Schaumschlägerei. Das Lied fällt in sich zusammen, franst erneut aus, es geht wieder zurück in die repetitiven Klangmuster. Die Snare knallt, das Becken haucht, die Gitarrenklänge irrlichtern durch den verschneiten Birkenwald auf dem Plattencover.
Im Bett wieder Ruhepuls, Sonntagspuls. Man zieht die Decke höher.
Vor die Tür kann man ja auch morgen.
„The White Birch“ von Codeine ist im Jahr 1994 bei Sub Pop erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Serie ÜBER DIE JAHRE
(25) The Smiths: „The Queen Is Dead“ (1986)
(24) Young Marble Giants: „Colossal Youth“ (1980)
(23) Sister Sledge: „We Are Family“ (1979)
(22) Rechenzentrum: „The John Peel Session“ (2001)
(21) Sonic Youth: „Goo“ (1990)
(20) Flanger: „Spirituals“ (2005)
(19) DAF: „Alles ist gut“ (1981)
(18) Gorilla Biscuits: „Start Today“ (1989)
(17) ABC: „The Lexicon Of Love“ (1982)
(16) Funny van Dannen: „Uruguay“ (1999)
(15) The Cure: „The Head On The Door“ (1985)
(14) Can: „Tago Mago“ (1971)
(13) Nico: „Chelsea Girl“ (1968)
(12) Byrds: „Sweetheart Of The Rodeo“ (1968)
(11) Sender Freie Rakete: „Keine gute Frau“ (2005)
(10) Herbie Hancock: „Sextant“ (1973)
(9) Depeche Mode: „Violator“ (1990)
(8) Stevie Wonder: „Music Of My Mind“ (1972)
(7) Tim Hardin: „1“ (1966)
(6) Cpt. Kirk &.: „Reformhölle“ (1992)
(5) Chico Buarque: „Construção“ (1971)
(4) The Mothers of Invention: „Absolutely Free“ (1967)
(3) Soweto Kinch: „Conversations With The Unseen“ (2003)
(2) Syd Barrett: „The Madcap Laughs“ (1970)
(1) Fehlfarben: „Monarchie und Alltag“ (1980)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik