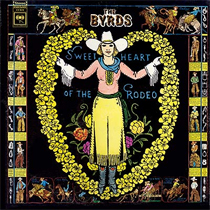Huch, was ist das? Trompeten und Posaunen? Cursive haben das Cello in den Schrank gestellt und mischen auf „Happy Hollow“ Blechbläser in ihre verschrobene Gitarrenmusik. Ein wenig abenteuerlich klingt das schon

Ein Holzfällerhemd, Dreitagebart, nachlässig geschnittenes Haar, ein gewitztes Grinsen. Tim Kasher ist kein Hochglanzrocker, eher Sägewerkpunk. Seit zehn Jahren erfreut er mit seiner Band Cursive aus dem US-Bundesstaat Nebraska Liebhaber trauriger, dissonanter Lieder. Ein introspektives, zynisches Konzeptalbum widmete er der Misere seiner Scheidung. Auf der letzten Platte The Ugly Organ verarbeitete er die Probleme, die die Bekanntheit als Popstar mit sich bringt.
Von Tim Kashers Selbstkasteiungen ist auf Cursives neuem Album Happy Hollow nichts zu hören. Seine Texte nehmen sich dieses Mal die ländliche Tristesse des Bibelgürtels vor, die Staaten von Nebraska bis Virginia. Im ersten Stück Opening the Hymnal heißt es nun: „Welcome one and welcome all to our small town“. Sie unternehmen einen Rundgang durch diese amerikanische Kleinstadt, führen uns in Hinterhöfe, Schlafzimmer, Fabriken und Kirchen, zeigen uns die zerbrochenen Träume der Einwohner. Die von Dorothy zum Beispiel, die darauf wartet, dass ein Wirbelsturm ihr Haus einfach davonträgt in die Smaragdstadt, in der alles besser wird – ähnlich wie in dem Buch Der Zauberer von Oz.
Das Landleben Amerikas wird nicht glorifiziert, nicht die endlosen Weiten der Felder, der klare Sternenhimmel und der alte rote Pick-Up romantisch verklärt. Cursive erzählen von der Hoffnungslosigkeit, der religiösen Bigotterie und anderen Schrecken, die sich jenseits der Millionenstädte finden. Das verpacken sie in verschrobenen Rock. Aus den Gitarren brechen windschiefe Töne hervor. Laut und ungehalten, treibend und dissonant, umtanzen sie Tim Kashers gepressten, labilen Gesang.
Ein bestimmendes Element der letzten Alben fehlt, das Cello. Es verlieh den Liedern Eindringlichkeit. Ein großer Verlust. Doch was klingt da zwischendrin? Das sind Blechbläser! Ein Ensemble aus Saxofon, Trompete und Posaune schnarrt und quietscht wie ein manischer Spielmannszug. Die Einsätze sind rhythmisch und perkussiv und fahren Weckrufen gleich durch die Holzhäuschen von Happy Hollow, die sich auf der Albumhülle in Sepia ducken zwischen dörrendem Gestrüpp. Ehe Kasher allen Einwohnern „This City is killing us“ in die Gesichter brüllt. Die Kombination aus verzerrten Gitarren und Blechgebläse klingt bisweilen ein wenig abenteuerlich, stellenweise sogar anstrengend.
Was im Vergleich zu früheren Aufnahmen auch fehlt, ist das Dräuende, Mystische – das, was Cursive auf The Ugly Organ auszeichnete. Das liegt an der zuweilen fahrigen Struktur der Lieder. Hier klingt ein wenig rauchiger Stampfblues durch, wie in Dorothy Dreams Of Tornados, dort Gospel in Retreat!, aber selten zeigt sich die schroffe Gitarrenmusik, die so orchestral und schaurig klingen kann. Musik, die irgendwo eine leiernde Drehorgel hervorzauberte und trotzdem nicht überladen oder aufgesetzt klang.
Auf Happy Hollow lassen sich ab und zu auch noch Spuren dieser Brillanz finden. Man muss nur genau hinhören.
„Happy Hollow“ von Cursive ist als LP und CD erschienen bei Saddle Creek
Hören Sie hier ![]() „Dorothy At Forty“
„Dorothy At Forty“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
Sport: „Aufstieg und Fall der Gruppe Sport“ (Strange Ways 2006)
Sender Freie Rakete: „Keine gute Frau“ (Eigenverlag 2005)
Cpt. Kirk &. „Reformhölle“ (Whats So Funn About 1992)
The Mothers Of Invention: „Absolutely Free“ (Ryko 1967)
Fehlfarben: „Monarchie und Alltag“ (EMI 1980)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik