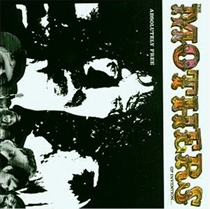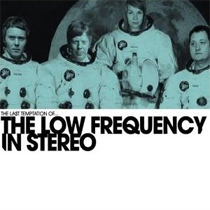Über die Jahre (5): Im August widmet sich der Tonträger Platten aus vergangenen Tagen. Heute: Chico Buarque, der 1971 Samba und Bossa nutzte, um pointierte Kritik an Brasiliens Militärdiktatur zu üben

Es ist 1971, Chico Buarque ist gerade aus dem italienischen Exil in seine Heimat Brasilien zurückgekehrt. Die Bedingungen unter der Militärdiktatur haben sich verschlechtert. Offene Kritik ist unmöglich, es herrscht die Zensur. Unter diesem Eindruck nimmt Chico Buarque ein Album auf, das deutlich düsterer ist, als seine vier Vorgänger: Construção.
Seite eins ist dominiert von komplizierten und dichten Texten und ausladenden, raffinierten Arrangements in Moll. In Cotidiano (Alltag) klingt Buarque resigniert. Der Song schildert aus der Perspektive eines Arbeiters die Monotonie des Alltags. Leitthema sind die wiederkehrenden Küsse seiner Frau, die gleichzeitig einen Hinweis auf ihr ebenso monotones Leben geben und ihre verzweifelten Versuche, auszubrechen. Am Ende wird die erste Strophe wiederholt, alles beginnt von vorne. Es folgt Desalento, der wohl traurigste Samba der Musikgeschichte. Stand der Samba in Buarques Werk bisher für Gemeinschaft und Lebensfreude, kommuniziert er hier nur Isolation und Absturz.
Das Titelstück Construção handelt vom Tod eines Bauarbeiters. Begleitet von bedrohlich wirbelnden Streicherfiguren und brutalen Bläsersätzen ist es eine Kritik an den schlechten Arbeitsverhältnissen im Land. Während der Tod lediglich eine Irritation im Ablauf des Alltags verursacht, bringt er die Strophen Buarques nachhaltig durcheinander. Am Ende des Stücks steht die Wiederholung von Textteilen aus dem Anfangsstück Deus Lhe Pague (Gott vergelt’s ihnen), eine poetisch verschlüsselte Anklage der Passivität der Menschen unter der Militärdiktatur. Dieses Wiederaufgreifen von Themen verleiht der ersten Seite des Albums einen Suite-artigen Zusammenhang. Dagegen nimmt sich die zweite Seite fast konventionell aus. Die Bossa- und Sambastrukturen werden aber auch hier von subtilen Dissonanzen und unterschwelliger Resignation im Vortrag unterwandert.
Construção ist ein Meilenstein der Popmusik, der Pet Sounds von den Beach Boys in seinem harmonischen Einfallsreichtum und der Raffinesse der Arrangements mindestens ebenbürtig ist. Lyrisch hingegen ist die Platte überlegen. Die pointierte Kritik wird in eine poetische, von gewitzten Wortspielen durchzogene Sprache transformiert, die den konkreten Anlass transzendiert.
Das Klischee von der ungebrochenen Leichtigkeit und Unbeschwertheit der zugrunde liegenden Formen wie Samba und Bossa Nova ist ein für alle mal zerstört. Und doch ist Construção nie erdrückend schwermütig. Man kann die zahlreichen Subtexte auch ignorieren – zumal wenn man des Portugiesischen nicht mächtig ist – und sich am musikalischen Reichtum berauschen.
„Construção“ von Chico Buarque ist als CD erhältlich bei Emarcy/Universal
Hören Sie hier ![]() „Desalento“
„Desalento“
…
Weitere Beiträge aus der Serie ÜBER DIE JAHRE
(4) The Mothers of Invention: „Absolutely Free“ (1967)
(3) Soweto Kinch: „Conversations With The Unseen“ (2003)
(2) Syd Barrett: „The Madcap Laughs“ (1970)
(1) Fehlfarben: „Monarchie und Alltag“ (1980)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik