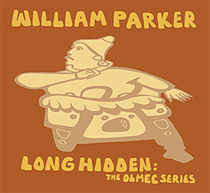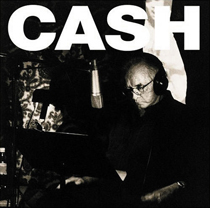Helena Noguerra ist Romanautorin, TV-Moderatorin, Fotomodell und Musikerin. Unter dem Pseudonym Dillinger Girl träumt sie zusammen mit Federico Pellegrini alias Baby Face Nelson von Liebe, Gangstertum und amerikanischen Weiten
Bang! So karg wie der Name ist das ganze Album: Akustikgitarre und Stimme, mehr braucht Popmusik nicht. Eine dunkelhaarige Schönheit und ein Glatzkopf mit einem Geldschein zwischen den Lippen posieren auf der Hülle. Bonnie & Clyde sind wieder da. Fast 40 Jahre nach Serge Gainsbourg: ein Lächeln in den Augen und das Herz voller Verse. Zärtlich, brutal, ein musikalischer Gangsterfilm in Technicolor.
„Schlag mich hart“, haucht die unschuldige Schönheit, „damit ich ein wenig Traurigkeit in deinen Augen sehen kann.“ Später singt sie von der verlorenen Zeit, von all den Liebkosungen ihres Geliebten. „Wenn es einen Gott gibt, dann wirst du es sein, mon amour.“ Bars gibt es viele in diesem Liederreigen, zu trinken reichlich. Und irgendwann ist es Zeit, Veränderungen herbeizuführen, „Schweine fliegen zu lassen“.
Geschrieben und komponiert hat das Federico Pellegrini, der früher mit der französischen Rockband The Little Rabbits Musik machte und dessen aktuelles Projekt The French Cowboy heißt. Helena Noguerra und er – nur zwei Stimmen und eine Handvoll Akkorde. Ein leichter Hall bildet den Chor, eine Melodie wird gezupft für eine Ewigkeit, für die Wüste von Arizona. Dort, in Tucson, ist das Album eingespielt worden. Man hört es ihm an. So klingt Amerika in Frankreich.
„Ich hatte Lust auf ein amerikanisches Album, so in der Art von Hope Sandoval und Jessy Sykes“, sagt Helena Noguerra im Interview. Mit ihrem Mann, dem Musiker Philippe Katerine, hat sie bereits den Bossa Nova und den Pop erkundet. Kylie Minogues Can’t Get You Out Of My Mind verzärtelten die beiden auf dem Album Née Dans La Nature. „Ich versuche mich ständig neu zu definieren“, sagt sie. „Deshalb habe ich mich am Bossa Nova versucht, am Chanson, am Rock. Ich finde es zu schwierig, endgültig, definitiv jemand zu sein.“ Ihre Eltern haben sie in die Filme von Ingmar Bergman und Jean-Luc Godard geschleppt. In die von Spielberg nicht. „Ich bin das Produkt meiner Epoche“, sagt sie. Mit Dillinger Girl & Baby Face Nelson strebt portugiesisch-belgisch-französische Sängerin einem neuen Höhepunkt zu.
Dabei hatte sie als Kind doch Schauspielerin werden wollen, „so wie Shirley MacLaine“. „Ich wollte singen, tanzen und Filme drehen. Deshalb habe ich mir eine Persönlichkeit erfunden. Ich spielte Schriftstellerin, Sängerin, Schauspielerin, Fernseh-Moderatorin. Ich spiele!“ Die Rolle als Sängerin füllt sie überzeugend aus. In Saint-Malo steht sie mit Blick aufs Meer am Mikrofon und singt. Wie ein trotziges Mädchen, das sich die Jeans über den nassen Badeanzug gezogen hat. Shirley MacLaine ist weit weg. Vergessen sind die Plastik-Pop-Momente, ihre Anfänge, das Album Projet Bikini.
Bang! schwebt in einer anderen Dimension. Pellegrini wollte das Album opulent orchestrieren. Aber Nogiuerra verliebte sich in die ersten Aufnahmen, in das Band, das er ihr geschickt hatte.
„je serai là où tu iras mon amour
là où tu iras, je serai mon amour
s’il y a un dieu, ce sera toi
s’il y a un dieu,
ce sera tout, mon amour“
„Bang!“ von Dillinger Girl & Baby Face Nelson ist erschienen bei Emarcy/Universal
Hören Sie hier ![]() „Love“
„Love“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Trost: „Trust Me“ (Four Music 2006)
Soffy O.: „The Beauty Of It“ (Virgin/EMI 2006)
I’m From Barcelona: „Let Me Introduce My Friends“ (Labels 2006)
The Whitest Boy Alive: „Dreams“ (Bubbles 2006)
Nico: „Chelsea Girl“ (Polydor 1968)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik