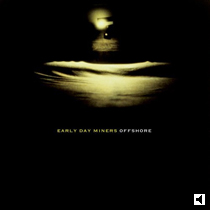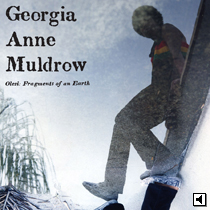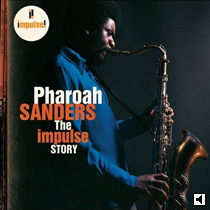Vert hatte seine neue Platte fast fertig, da stahl man ihm den Computer. Sein mutiger Neuanfang heißt „Some Beans & An Octopus“ und ist eine Revue mit Vibrafon, Orffschen Instrumentierungen, mehrstimmigem Gesang, Rap und Quietscheenten
Viele Musiker behaupten, Genrebegriffe wären nur Werkzeuge für Journalisten. Wie die Rohrzange für den Klempner. Und Elektronik kein Genre, sondern eine Herangehensweise, eben auch nur ein Werkzeug. Mit Computern und Samplern lässt sich schließlich vieles anstellen: Techno, HipHop, Tango, Rock, Klassik, wahrscheinlich gibt es sogar ein Programm, das Alphorn spielen kann.
Adam Butler hat unter dem Namen Vert drei Platten mit avantgardistischer Elektronik aufgenommen. Dann hat man ihm sein Werkzeug entwendet. Einbrecher drangen in sein Studio ein und nahmen Computer und Mischpult mit. Mit dem Computer ging die Festplatte, mit der Festplatte die Entwürfe für seine neue Platte. Was sollte er tun? Buchhalter werden?
Butler hat einen Neuanfang gewagt. Er heißt Some Beans & An Octopus und klingt überhaupt nicht nach Frust. Schon der Titel klingt phantasievoll und nach einer exotischen Mahlzeit mit Ballaststoffen, Eiweiß und Proteinen. Die Musik bestätigt die Assoziation, greifbarer ist sie geworden, organischer.
Wir hören ein Saxofon und ein Vibrafon, Orffsche Instrumentierungen, mehrstimmigen Gesang, Rap und Quietscheenten. Der Ragtime stolpert auf dem Klavier, Vert entführt uns in einen Saloon der Unterwasserwelt. Eben winkt noch der Titel-Oktopus an der Luke, da gibt es schon wieder Beutelrattenfleisch mit Bohnen. Dazu trommelt ein Elefantenmensch auf Knochen. Ach, und da drüben schlendert Tom Waits vorbei. Er ist nüchtern und hält ein Glas Mango-Cola in der Hand. In welche Schublade passt das bloß hinein?
In gar keine. Some Beans & An Octopus ist eine verschrobene Revue. Hören Sie diese CD am besten in der Badewanne, im Walkman auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst oder beim biodynamischen Gärtnern. Seufzen Sie im Chor zu October. Die Musik hat so viel Charme und Poesie, zeitweise wähnt man sich in einem tschechischen Märchenfilm.
Im Laden wird Some Beans & An Octopus wahrscheinlich dennoch bei „Elektronik“ oder gar „Techno“ zu finden sein, denn da stehen die anderen Platten der Kölner Plattenfirma Sonig.
„Some Beans & An Octopus“ von Vert ist als LP und CD erschienen bei Sonig
Hören Sie hier ![]() „Gretchen Askew“ und „October“
„Gretchen Askew“ und „October“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
The Cure: „The Head On The Door“ (Fiction/Universal 1985)
Guther: „Sundet“ (Morr Music 2006)
Dillinger Girl & „Baby Face“ Nelson: „Bang!“ (Emarcy/Universal 2006)
Trost: „Trust Me“ (Four Music 2006)
Soffy O.: „The Beauty Of It“ (Virgin/EMI 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik