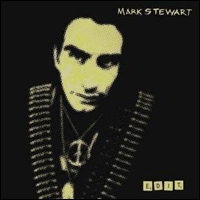Platte oder CD? Gute Frage. Als die CD eingeführt wurde, lockten viele Künstler mit Bonusstücken, die den Kauf des teureren Silberlings attraktiv machen sollten. Der Schallplatte drohte das Ende, als Anfang der Neunziger viele Alben nur noch auf CD erschienen. Es blieb ein kleiner Liebhabermarkt. Seit einiger Zeit nun produzieren selbst die großen Plattenfirmen wieder Schallplatten ihrer namhaften Popkünstler, Madonnas Hard Candy erscheint ebenso auf LP, wie das neue Alben von Coldplay. Mancher Plattenhülle liegen die digitalen Versionen der Lieder bei, anderen ein Schlüssel, mit Hilfe dessen man sie ganz umsonst aus dem Netz ziehen kann. Derweil soll der Absatz der CD wiederum durch limitierte Auflagen mit geschenkten DVD-Beilegern angekurbelt werden. Doch wie viel Bonus braucht der Mensch, um sich für die jeweilige CD oder LP zu entscheiden? Ein Musikvideo? Einen Film über die Band? Zwei, drei Lieder?
Das amerikanische Elektro-Duo Matmos macht dem Hörer die Entscheidung leicht. Sind auf der silbernen Version ihres neuen Werks Supreme Balloon sieben Stücke zu hören, schallen aus den schwarzen Rillen der Doppel-LP derer elf. Unter den vier vinyl-exklusiven Stücken sind einige der besten des Albums, auf einem davon, Hashish Master, improvisierte der Minimal-Musiker Terry Riley auf den Tasten. Die schweren Scheiben sind in stabilen Karton gebettet, die abstrakten Computerzeichnungen auf der Hülle der CD kaum zu erkennen – geschweige denn oben links in diesem Artikel. Wer die Platte kauft, kann sich alle elf Stücke von der Internetseite der Plattenfirma Matador in guter Qualität herunterladen. Da lohnt sich der Plattenkauf selbst für Menschen, die gar keinen Plattenspieler besitzen. Und er lohnt sich nicht nur, weil er dem Besitzer das Gefühl gibt, reich beschenkt worden zu sein. Er ist auch musikalisch durchaus sinnvoll.
Martin Schmidt und Drew Daniel sind Matmos, sie kommen aus San Francisco. Ihre bisher sechs Alben folgten jeweils einem experimentellen klanglichen Konzept. Auf The Civil War setzten sich Matmos im Jahr 2003 klanglich und inhaltlich mit dem britischem und dem amerikanischen Bürgerkrieg auseinander. Zwei Jahre zuvor fügten sie A Chance To Cut Is A Chance To Cure aus Klangschnipseln medizinischer Gerätschaften zusammen. Die Rhythmen bastelten sie aus den Geräuschen brechender Knochen und schneidender Skalpelle, Fettabsauger und chirurgische Laser spendeten minimalistische Melodien. Stellenweise klang das nach harmlosem Techno-Pop. Allein das ihrer Ratte gewidmete To Felix (And All The Rats) spielten sie auf dem Käfig des verstorbenen Tieres.
Die Vorgabe für das neue Album Supreme Balloon ist dagegen recht banal. Matmos versichern, man höre hier ausschließlich Synthesizer und kein einziges Mikrofon. Eine Elektronikband nimmt ein rein elektronisches Album auf, ist das wirklich etwas Besonderes? Bei Matmos schon, schließlich mussten sie nun ohne die vielen Klangfetzen ihrer Umwelt auskommen, ohne Küchengeräte, elektrische Zahnbürsten und Rattenkäfige. Klingen durfte nur, was im Synthesizer schon drin war.
Und was hier alles klingt!
Auf ihrer Internetseite erläutern die beiden Musiker recht genau, welche elektronischen Schätze und musikalischen Einflüsse zu hören sind und wo die verwendeten Instrumente bereits früher zu vernehmen waren. Hier ein modularer Doepfer Synthesizer, ein Korg MS-20 und ein ARP 2600, dort ein Dubreq Stylophone, ein Coupigny Synthesizer und ein Electro Comp 100. Man liest all diese Namen, ohne sie wirklich zu verstehen. Aber eines ist klar: Martin Schmidt und Drew Daniel haben den Keller voller Klangmacher – und sie sind vollkommen durchgedreht.
Und wie es klingt!
So abschreckend die Worte Experiment und Konzept wirken, so leicht man Kühle assoziiert, hört man Elektronik: Supreme Balloon strahlt eine heimelige Wärme aus, es lebt. Manch einer der Synthesizer ist beinahe 50 Jahre alt, viele Töne umgibt ein analoges Flirren. Rainbow Flag kokettiert mit einem lateinamerikanischen Rhythmus. Die torkelnde Melodie kommt aus dem Stylophone, einem kleinen Synthesizer, den man in der Hand hält und dessen winzige Tasten man mit einem Metallstab bedient. Zu Zeiten des Manchester Rave Ende der Achtziger tönte diese Taschenorgel in vielen Tanzkrachern.
Oder Polychords: Der Rhythmus stapft in Richtung Club, irgendein sicher namhafter Synthesizer schiebt harmonische Flächen hinterher. Zwischendurch brodelt und knarzt es kurz, wir tanzen auf der Stelle. Dann geht es steten Schrittes weiter, nach dreieinhalb Minuten sind wir angekommen, es ging viel zu schnell. Zemoi funktioniert ähnlich, kombiniert harte Rhythmen mit Hymnischem. Les Folies Francaises und Cloudhoppers sind expressionistische Spielereien ganz ohne Taktschlag. Ganz anders Mister Mouth und Exciter Lamp And The Variable Band, hier betreiben Matmos weniger leicht konsumierbare Rhythmusexperimente. Doch selbst aus dem Abstrakten schälen sich hier und da greifbare Melodien. Komplex klingen vor allem Hashish Master und das Titelstück, in ihnen kommt alles Vorhergenannte zusammen. Supreme Balloon nimmt die Seite D des Albums vollkommen ein und führt den Hörer vierundzwanzig Minuten lang durch die Höhen und Tiefen der Klangerforschung.
Supreme Ballroom wäre ein viel besserer Titel für dieses berauschende Album gewesen. Matmos bringen das elektronische Experiment zum Tanzen. Sie selbst nennen das: »Traditionelle synthetische Küche, serviert in ungezwungener Atmosphäre«. Da ist man gern zu Gast.
»Supreme Balloon« von Matmos ist auf CD und Doppel-LP bei Matador/Beggars Banquet erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ELEKTRONIKA
Kelley Polar: »I Need You To Hold On While The Sky Is Falling« (Environ/Alive 2008)
Munk: »Cloudbuster« (Gomma 2008)
Gustav: »Verlass die Stadt« (Chicks On Speed Records 2008)
Mark Stewart: »Edit« (Crippled Dick Hot Wax 2008)
Bishi: »Night At The Circus« (Gryphon 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik