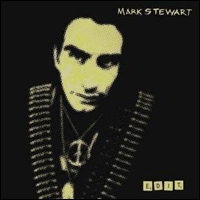Kevin Barnes hat eine blühende Phantasie. Er ist der Sänger und kreative Kopf der Band Of Montreal – wie sein Wahnsinn klingt, ist auf deren neuem Album Skeletal Lamping zu hören.
Das geht so: Alle paar Sekunden eine neue Idee, alle paar Sekunden ein Tempowechsel. Zu Beginn des ersten Stücks Nonpareil Of Favor überschlägt sich ein Spinett, kaum hat man bis fünf gezählt setzt ein trockenes Schlagzeug ein Kevin Barnes singt, als gelte es, den überkandidelten Pop der Sparks zu imitieren. Etliche Ausfallschritte später versinkt alles im Gitarrengewitter. Es sind kaum sechs Minuten vergangen, da hat man den Eindruck, schon mindestens vier verschiedene Lieder gehört zu haben.
Und so geht es weiter. Da trifft Funk auf Yellow Submarine und Gitarrengeschrammel auf Saturday Night Fever. So klänge wohl Vaudeville-Theater im Spielparadies eines Möbelmarktes am verkaufsoffenen Sonntag. Oder die Musical-Version von Alice im Wunderland. Die sechs Musiker aus – von wegen Montreal – Athens, Georgia zelebrieren eine knappe Stunde lang hysterisch den Wahnwitz – und sehen dabei aus, als parodierten sie den Glamrock der Siebziger. Das ist wohl Ironie.
Ironie lässt sich in den Texten und Titeln der Band schon immer reichlich finden. Eines ihrer früheren Lieder hieß – in Anlehnung an Velvet Undergrounds Venus In Furs – Vegan In Furs. In einem anderen erzählt Kevin Barnes davon, was er mit dem besten Freund anstellen würde, wäre er doch bloß ein Mädchen. Auf Skeletal Lamping indes dreht sich fast alles um Sex – und das recht explizit. Ein Fiebertraum der unterhaltsamen Sorte.
Kevin Barnes will irritieren. Auf seiner Internetseite ist zu lesen, er habe ein unvorhersehbares und schwieriges Album machen wollen. Er habe die übliche Wahrnehmung eines Popalbums demontieren wollen. Dabei ist Skeletal Lamping doch reinster Pop. Man kann es wie eine einzige lange Komposition hören. Oder wie eine Kollektion von 15 Popliedern. Oder wie die Aneinanderreihung tausender Klangfragmente.
Bleibt der Albumtitel: Lamping ist eine besonders brutale Art des nächtlichen Jagens. Dabei wird ein Jagdgebiet mit Licht geflutet und die in Panik versetzten Tiere niedergeschossen oder eingefangen. Er habe bei der Wahl des Titels an seine inneren Dämonen gedacht, sagt Kevin Barnes. Er wisse bloß noch nicht, ob er sie niederschießen oder einfangen solle.
„Skeletal Lamping“ von Of Montreal ist auf CD und LP bei Polyvinyl/Cargo Records erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Antony & The Johnsons: „Another World“ (Rough Trade/Indigo 2008)
The Cure: „4:13 Dream“ (Geffen/Universal)
Tindersticks: „I“ (This Way Up 1993)
Brian Wilson: „That Lucky Old Sun“ (Capitol/EMI 2008)
Dennis Wilson: „Pacific Ocean Blue“ (Caribou 1977/Sony BMG 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik