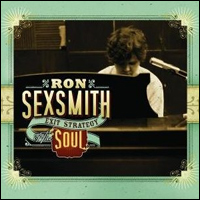Über die Jahre (40): Klaus Nomi aus Essen wurde in New York berühmt. Als gepuderter Poptenor an David Bowies Seite sprang er drei Jahre lang durch die Clubs, bis zu seinem tragischen Ende am 6. August 1983.

Androgyn und android. Sein Gesicht schminkte er weiß, die Lippen schwarz. Ein Roboter mit onduliertem Haar. Klaus Nomis tragische Ruhmesgeschichte dauerte nur wenige Jahre. Vor 25 Jahren starb der deutsche Kontratenor, einsam und verarmt.
Eines der ersten berühmten Aidsopfer, so wird er oft genannt. Bekannt war er in Deutschland kaum, dieser Sänger, der sich anzog, als sei er aus Oskar Schlemmers mechanischem Ballett gesprungen. In New York war das anders. Selbst Rockmusiker erstarrten, wenn er auftrat. Punks begannen zu weinen. Das erzählt man sich immer noch.
Er war plötzlich da.
David Bowie hatte ihn entdeckt. Ähnlich wie Nomi war er gegen Ende der siebziger Jahre im Futurismus hängen geblieben. Bowie sah ihn in einem New Yorker Club: Mit hartem deutschen Akzent sang Nomi von der Kraft der Liebe, der Apokalypse, in Falsett – gekleidet wie Andy Warhols Version der Königin der Nacht. Wie von einem fremden Stern.
Doch er kam bloß aus Immenstadt, einem bayrischen Dorf, zwischen Kempten und Alpsee gelegen. Da hieß er Klaus Sperber. In Essen wuchs er auf. Als er zwölf war, griff seine Mutter versehentlich in seine Karriere ein. Sperber hatte sich eine Elvis-Presley-Platte gekauft. Seine Mutter schleppte ihn zurück zum Geschäft und tauschte das Album um. In eines von Maria Callas. Elvis und Callas, Pop und Oper. Der junge Klaus wollte beides und auf die Bühne. Statistenrollen in Essen, Gesangsausbildung in Berlin – dann kam er an die Deutsche Oper, als Platzanweiser und Fahrstuhlwärter. Singen mochte ihn in Deutschland niemand hören.
In New York erging es ihm zunächst ähnlich. Jedes Theater lehnte ihn ab. So wandte er sich einem Beruf zu, der ähnlich zuckrige Kunstwerke hervor bringt: Er jobbte als Konditor – bis Bowie kam. Es war die Zeit des New Wave, Sperber wurde zu Nomi und trat in der Samstagabendsendung Saturday Night Live auf. In Frischhaltefolie verpackt sang er mit Bowie zusammen. So wurde er berühmt. Rock, Oper, Disco – Nomi ein Anagramm von „Omni“, „alles in einem“. Ein galaktischer Pierrot! Mechanisch sein Tanz, sein Gesang manchmal schauderhaft. In die New Yorker Clubs passte er perfekt.
Die erste Single erschien 1980: Keys Of Life. Das erste Album Nomi folgte, sein zweites und letztes hieß Simple Man. Nomi sang Marlene Dietrichs Falling in Love Again, Henry Purcells Cold Song, er vermischte schrille Arien mit dem Keyboard getriebenen New Wave. Weltraumoper – selten passte dieser Begriff besser. Der deutschen Presse galt er lange als Kuriosität. Thomas Gottschalk lud ihn 1982 ein, in seine Sendung Na sowas.
Ein Jahr später kam die Krankheit. Das Aids-Virus hatte noch keinen Namen, da lag Nomi im Hospital und starb. Mit nur 39 Jahren. Seine Bewunderer kamen nicht ins Krankenhaus, sie hatten Angst, sich anzustecken. Vor drei Jahren verfilmte der Regisseur Andrew Horn eine posthume Würdigung: The Nomi Song. Bis dahin wussten wenige, was er hinter all dem Plastik und Puder verbarg: einen einsamen Menschen voller Lebensangst und Zweifel.
Das Debütalbum von Klaus Nomi ist im Jahr 1981 bei RCA erschienen und heute als CD über Sony BMG erhältlich.
…
Weitere Beiträge aus der Serie ÜBER DIE JAHRE
(39) GAS: »Nah und Fern« (Kompakt/Rough Trade 2008)
(38) Liquid Liquid: »Slip In And Out Of Phenomenon« (2008)
(37) Nick Drake: »Fruit Tree« (1979)
(36) The Sonics: »Here Are The Sonics!!!« (1965)
(35) dEUS: »In A Bar, Under The Sea« (1996)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik