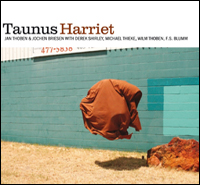Bislang wurden The Notwist von Album zu Album besser. Mit ihrer sechsten Platte „The Devil, You + Me“ reißt die Serie ab, die Feuilletons loben sie trotzdem.
Über The Notwist möchte man wohlwollend schreiben. Und wie einfach ließe sich in die Elogen einstimmen, zu denen die Feuilletons in den vergangenen Wochen anhoben, ließe sich wortreich beschreiben, wie überaus glaubwürdig und integer sich die Band im korrupten Musikgeschäft bewegt, ließe sich ausführen, wie die oberbayerische Gruppe seit Mitte der Neunziger ein überzeugendes Werk nach dem anderen ersinnt, sich ein ums andere Mal neu erfindet, und ließe sich schließlich schlussfolgern, auch die neue Platte The Devil, You + Me müsse ein Meisterwerk sein.
Allein, so wahr alles vorher Gesagte sein mag, ein Meisterwerk ist The Devil, You + Me leider nicht.
Bisher schien jede Notwist-Platte der letzte Schluss dessen zu sein, was derzeit im eigenen Tonuniversum möglich war. Mehr noch, zumindest eine Weile lang klang jedes Album seit 12 wie das Großartigste, was Musiker auf Instrumenten anstellen können. Mit einigen Jahren Abstand veränderten die Platten ihren Charakter, erwiesen sich doch nur als sinnvolle Fortschreibung des vorherigen Albums. Nicht weniger gut, aber viel weniger endgültig. Was folgte, drängte die Grenzen des Universums jedes Mal noch ein bisschen weiter zurück.
Anfang der Neunziger nahmen The Notwist zwei beinharte Rockplatten auf. Hört man The Notwist und Nook heute, so erahnt man Vieles von dem, was längst als typisch gilt. Zwischen Bergmassiven aus Gitarre und dem Gewitter der Basstrommel schweben schon diese gepressten Melodien, diese ungewöhnlichen Harmonien, diese sanfte Stimme. Freilich war damals nicht zu erahnen, wohin die Reise gehen sollte. Die Punk-Bands Bad Religion und Therapy? nahmen The Notwist mit auf Tour.
Überhaupt, Markus Achers Stimme. Akrobatisch ist sie nicht, allenfalls schafft sie kleine Bodenturnereien. Hier ein beschaulicher Hüpfer, dort eine elegante Rolle. Achers Stimme ist das Imperfekte im Orchester der Perfektion. Wo sonst jeder Klick sitzt und jeder Streicher um die Hierarchien weiß, ist sie der Puls, das Organische. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das Orchester wurde über die Jahre immer präziser, sein Englisch nicht. Wozu auch.
Jeder musikalische Schritt der Band erschien letztlich logisch: Mitte der Neunziger veröffentlichten sie 12, erstmals steuerte Martin Gretschmann alias Console elektronische Klänge bei. Sie umschwirrten die Gitarrenmonumente, vermochten ihre Oberfläche aber kaum anzukratzen. Gretschmann wurde festes Mitglied der Gruppe. Auf Shrink im Jahr 1998 klangen die Gitarren weniger massiv, die Elektronik trat in den Vordergrund. Post-Rock wurde die Musik der Band genannt, vielleicht weil die Rockergeste nie ihre war – der Eklektizismus um so mehr. Solch eine Mischung aus Gitarren und Elektronik war damals unerhört. Shrink brachte den Durchbruch, Day 7 und Chemicals waren kleine Erfolge. The Notwist fuhren nun mit den Orgeldudlern von Stereolab auf Tour.
Seit Shrink wurden die Pausen zwischen den Alben lang, ebenso die Veröffentlichungsliste assoziierter Projekte – Console, Lali Puna, Tied + Tickled Trio, MS John Soda und einige mehr. Erst im Jahr 2002 erschien Neon Golden, eine wahrhaft umwerfende Platte. Aus Post-Rock war nun Diskurs-Pop geworden, Musik, die in immer neue Kontexte einsortiert wurde, über die man nie genug wusste, und die am Ende bis ins Absurde überhöht wurde. Jörg Adolphs Dokumentarfilm über die Entstehung der Platte, On/Off The Record, führte das vor Augen. Man sieht: Die Journalisten stellen anbiedernd umständliche Fragen, die Musiker schauen und schweigen. Ganz so als verstünden sie gar nicht, weshalb man über Musik noch reden müsse. Mit den zehn Stücken auf Neon Golden war doch alles gesagt.
Wie macht man eine neue Platte, wenn alles gesagt ist? Wenn die Erwartungshaltung in den Himmel gewachsen ist? Geht man weiter vorwärts? Mal wieder rückwärts? Oder macht man einfach Neon Golden, Teil 2? The Notwist wussten es offenbar auch nicht so genau. So ist The Devil, You + Me von allem ein bisschen. Die leicht rumpeligen Stücke Good Lies und Alphabet erweisen Shrink die Referenz, Gravity wiederum hätte gut zu Neon Golden gepasst.
Das Vorwärts jedoch wird zum Problem. Denn das ins Studio geladene zwanzigköpfige Orchester vermag der Unternehmung keine Spannung zu verleihen. Im Gegenteil, die recht spärlich eingestreuten Filmmusikklänge sind fast alle überflüssig. Sie versenken die feine Elektronika der Single Where In This World im Kleister. Die Streicher in Hands On Us erinnern an die Tindersticks – die wissen schon, weshalb auf ihren Platten weder Schlagzeugcomputer noch Elektronikrauschen zu hören sind. Hier nun kippt die Düsternis ins Melodramatische.
Es vergeht eine halbe Ewigkeit, bis das Genie der Band endlich aufblitzt. Stück Nummer 6, Gravity, lebt von dem Gegensatz zwischen dem flirrend vertrackten Schlagzeug und den ruhig vorgetragenen Worten – und dem, woran es den meisten anderen Stücken fehlt: einer brillanten Melodie. Hier bringt die Band es klanglich auf den Punkt, hier bekommt sie – welch passenden Titel trägt das Stück – die Füße an den Boden. Danach heben The Notwist wieder ab und landen erst bei Boneless wieder. Da ist das Album beinahe vorbei. „Old gravity won’t get me“, singt Acher einmal, das klingt programmatisch.
Diese Träne muss hier nun vergossen werden: Neon Golden hörte man immer wieder etwas Neues an, die Lieder übten eine Anziehungskraft aus. Monatelang fesselte das Album den Hörer. The Devil, You + Me ist im Vergleich dazu kraftlos. Auch beim dreißigsten Durchlauf noch klingen viele Melodien flach, dümpeln Lieder wie Sleep und Hands On Us ziellos vor sich hin.
Nun: Wie macht man also eine neue Platte, wenn alles gesagt ist? The Devil, You + Me klingt, als wüssten auch The Notwist keine Antwort.
„The Devil, You + Me“ von The Notwist ist als CD und LP erschienen bei City Slang.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Yeasayer: „All Hour Cymbals“ (We Are Free/Cargo 2007)
Portishead: „Third“ (Island/Universal 2008)
Gnarls Barkley: „The Odd Couple“ (Warner 2008)
Taunus: „Harriet“ (Ahornfelder 2008)
Billy Bragg: „Mr. Love & Justice“ (Cooking Vinyl 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik