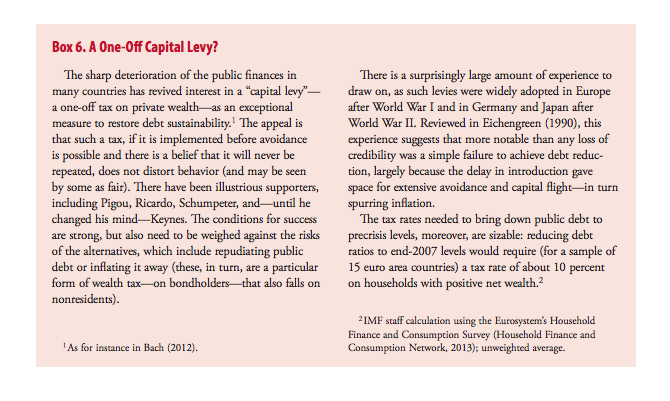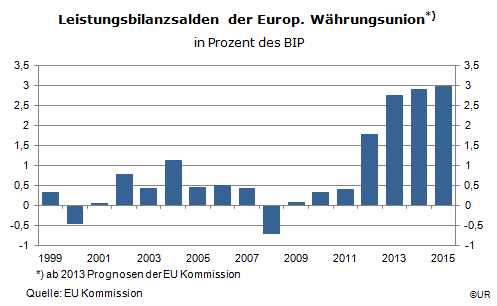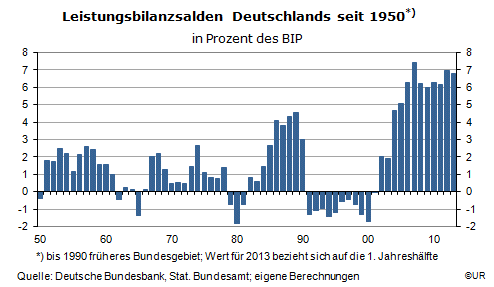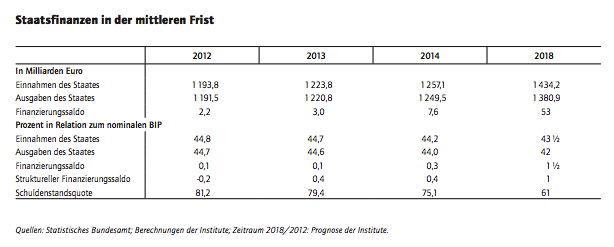Marcel Fratzscher, Philipp König und Claudia Lambert vom DIW haben eine sehr interessante Analyse zu den Target-Salden der EZB veröffentlicht, die dazu beitragen kann, die Debatte in Deutschland zu versachlichen.
Wir erinnern uns: In dem Target-Streit ging es um die Frage, ob sich aus dem Zahlungsverkehrssystem der Notenbanken zusätzlich parlamentarisch nicht kontrollierte Risiken für Deutschland ergeben. Die These von Fratzscher et al: Deutschland hat von der Flexibilität des Target-2-Systems profitiert, weil es die Rückführung von im Ausland angelegtem Kapital ermöglichte, das sonst womöglich verloren gewesen wäre.
Sie definieren zunächst einmal, worüber wir eigentlich reden:
Handelt es sich bei der schließlich verbuchten T2-Position um eine Forderung gegenüber der EZB, so ist den Banken eines Landes mehr Zentralbankgeld aus dem Ausland zugeflossen, als sie dorthin überwiesen haben. Im Falle einer Verbindlichkeit gegenüber der EZB haben die Banken mehr Zentralbankgeld an das Ausland überwiesen, als sie von dort empfangen haben
Dann kommen sie zum Punkt:
Deutsche Banken und Anleger haben ihre Forderungen gegenüber Griechenland, Italien, Irland, Portugal, Spanien und Zypern seit dem Jahr 2007 um rund 390 Milliarden Euro reduziert. Dass deutsche Anleger ihre Investitionen in großem Umfang ohne noch gravierendere Verwerfungen an den Finanzmärkten aus diesen Ländern abziehen konnten, ist vor allem begründet in der Bereitstellung unbeschränkter Liquidität im Rahmen des Vollzuteilungsverfahrens des Eurosystems und im reibungslos funktionierenden Zahlungssystem Target2.
Sebastian Dullien und ich haben vor einiger Zeit bei vox.eu ähnlich argumentiert.
Das DIW geht auch auf das Argument ein, die Liquiditätsbereitstellung über Target 2 verhindere eine Anpassung der Leistungsbilanzen – ein Argument, dessen Problematik schon daran deutlich wird, dass sich inzwischen fast alle Leistungsbilanzen angepasst haben.
Zu Recht wird von den Autoren darauf hingewiesen, dass die Anpassungspfade in einer Währungsunion anders verlaufen müssen als in einem Land mit eigenständiger Geldpolitik, weil keine Abwertung stattfinden kann. Deshalb braucht die Anpassung länger und muss unterstützt werden.
Die Konsequenzen der alternativen Vorgehensweise – keine Liquiditätsbereitstellung mit der Folge einer schlagartig erzwungenen Anpassung – wären hingegen fatal gewesen, sowohl für die Krisenländer selbst als auch für die Eurozone als Ganzes.
Und nun, Hans-Werner Sinn?