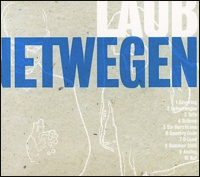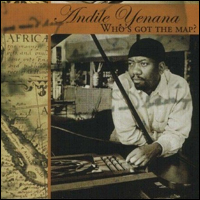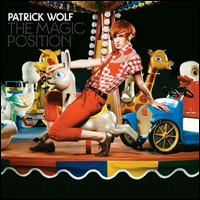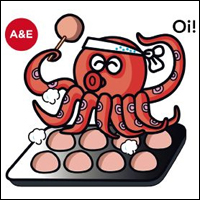Im vergangenen Jahr feierte Bugge Wesseltofts Label Jazzland Recordings seinen zehnten Geburtstag. Aus diesem Anlass sollte es ein paar Jubiläumsauftritte in Norwegen geben, schließlich wurde daraus eine Konzertreise durch ganz Europa. Die Auftritte in Hamburg, Köln und Oslo wurden mitgeschnitten, Teile davon erscheinen jetzt auf der CD Jazzland Community: Live. Mit dabei sind neben Wesseltoft die Sängerin Sidsel Endresen, der Gitarrist Eivind Aarset, der Saxofonist Hakon Kornstad, der Bassist Marius Reksjo und der Schlagzeuger Wetle Holte.
Wesseltofts New Conceptions of Jazz hatten ihm und der Firma gleich zu Beginn großen Erfolg und internationale Beachtung beschert. Der junge norwegische Jazz ist seitdem auf den europäischen Festivals präsent, sicher nicht nur, weil der norwegische Staat seine Künstler bei Auslandstourneen finanziell unterstützt. Talentierten Nachwuchs gibt es in der norwegischen Metropole offenbar zuhauf. Die letzten kreativen Töne aus den USA seien mindestens vierzig Jahre alt, behauptet Wesseltoft. Das Zentrum für neue spannende Musik habe sich seitdem mehr und mehr nach Europa verlagert. Gerade in Skandinavien gibt es eine Menge guter Musiker, die an Klängen basteln, die einst vom Label ECM groß und bekannt gemacht wurden. Wesseltoft interessiert besonders die elektroakustische Welt, jene Mischung aus Jazz und elektronischer Musik, die als sehr europäische Kunstform gilt.
Er schwärmt von den Künstlern, die einst mit zeitgenössischer Musik und frühem Techno experimentierten und berichtet, dass Berlin in jener Entwicklung eine maßgebliche Rolle gespielt habe. Höhepunkte auf Jazzland Community: Live sind die Stücke mit Wesseltofts langjähriger musikalischer Partnerin Sidsel Endresen. Ihre Stimme betört, sie ist sehr weit entfernt von der Tradition des Jazz. Auch sie begrüßt es, dass die amerikanische Dominanz des Jazz in der öffentlichen Wahrnehmung bröckelt. Sie mag Billie Holiday und Chet Baker, doch die zahlreichen stilistischen Klischees, die es im Jazzgesang gibt, gefallen ihr nicht. Trotz großem Respekt für Ella Fitzgerald und Scat-Gesang habe sie diese Musik eigentlich nie wirklich hören mögen, gesteht Endresen. Deshalb schaute sie sich nach anderen Quellen um und nach neuen Wegen, ihre Stimme als Instrument einzusetzen. Das ethnische Segment wurde ihr zu einer großen Inspirationsquelle, Jan Garbarek ebnete da schon vor über dreißig Jahren Wege.
Die New Yorker Szene fühle sich keineswegs rückständig, auch wenn neue Töne von ihr zurzeit nur sehr spärlich kommen. Ihr sei wohl das Widerstandspotenzial abhanden gekommen, vermutet Endresen. Für sie ist klar, dass sich die Dinge auch wieder ändern werden. Bis dahin genießt sie das starke Interesse an der norwegischen Szene.
„Jazzland Community: Live“ ist erschienen bei Jazzland Recordings/Universal
Zur Veröffentlichung der CD startet die Jazzland Community ihr sogenanntes Sommercamp in Berlin. Vom 27.5. bis 17.7. spielen jeden Sonntag die Jazzland-Künstler auf dem Badeschiff. Hakon Kornstad eröffnet die Reihe am 27.5., Sidsel Endresen tritt zusammen mit Jan Bang am 3.6. auf, Bugge Wesseltoft spielt am 10.6. ein Soloklavierkonzert. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 3 Euro.
Sidsel Endresen tritt auch beim Moers-Festival auf. Christian Broecking berichtet darüber in unserem Festival-Blog ZELT online
...
Weitere Beiträge aus der Kategorie JAZZ
Andile Yenana: „Who's Got The Map?“ (Sheer Sound/Rough Trade 2007)
Arve Henriksen: „Strjon“ (Rune Grammofon 2007)
Cor Fuhler: „Stengam“ (Potlatch 2006)
Metheny/Mehldau: „Quartette“ (Nonesuch 2007)
Grunert: „Construction Kit“ (Hongkong Recordings 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik