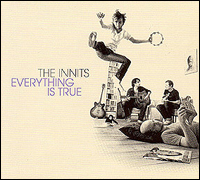Das Schlimmste an Weihnachten ist die Musik! Mal ehrlich: Weihnachtsplatten sind das Gaukelwerk abgehalfterter Popstars. Die schnelle Mark mit der eigenen Einfallslosigkeit und dem Wärmebedürfnis der Fans zu verdienen, ist so abstoßend wie zynisch.
Es gibt wenige Ausnahmen. Zwischen den grellen Lämpchen von Wham und Chris Rea, Céline Dion und André Rieu funkelt verhalten ein warmes Bienenwachskerzenlicht: Christmas von der Gruppe Low, einem Trio aus Duluth, Minnesota. Angeführt vom Mormonenpaar Alan Sparhawk und Mimi Parker machen sie andächtige Musik, die ohne Kitsch auskommt. Lange galten sie als langsamste Band der Welt. Low spielen in Minimalbesetzung, zu dritt stehen sie aufgereiht vor einem roten Vorhang: rechts der Bass von Zak Sally, links die Gitarre von Alan Sparhawk und in der Mitte Mimi Parker mit Mikrofon und etwas Schlagwerk. Ist das Pop? Ist das Rock? Oder etwa Folk? Egal.
Töne stellen sie in den Raum, breiten sie aus, lassen sie verhallen. Darüber schwebt ein Gesang, der das Herz erwärmt. Alan Sparhawk und Mimi Parker harmonieren hervorragend. Wenn sie zusammen ins Mikrofon hauchen, entstehen Momente der Magie. Die Welt bleibt einen Augenblick stehen, man kann durchatmen und Geschehenes betrachten.
Im Jahr 1999 haben Low dieses Album aufgenommen, es befinden sich acht Weihnachtslieder darauf. Sie haben die CD im Eigenverlag veröffentlicht – eigentlich nur für einen kleine Fangemeinde. Seither wird es immer wieder aufgelegt. Christmas verbindet weihnachtlichen Frohsinn mit Melancholie und Düsterkeit. Low spielen darauf einige klassische Weihnachtslieder wie Little Drummer Boy und Silent Night in sehr ruhigen Versionen. Ihr Blue Christmas ist White Christmas für Trauerklöße. Das Stück haben schon Elvis, Céline Dion und der Punkrocker Billy Idol gesungen, bei Low leuchtet es wie der Polarstern: „You’ll be doing alright with your christmas of white“. Aus Mimi Parkers Stimme klingt eine Spur abgründigen Humors. Dazu gibt es eigene Stücke der Band zu hören.
Christmas ist eine ungewöhnlich kunstvolle Platte. Im Gesang herrscht Harmonie, in der Musik tauchen immer wieder Dissonanzen auf. Sparsam streut Zak Sally seine dumpfen Töne ein. Low sind moderne religiöse Künstler, sie machen religiöse Kunst modern. Zur Hintergrundbeschallung beim Auspacken der Geschenke ist diese Platte zu schade.
„Christmas“ von Low ist erstmals im Jahr 1999 bei Chairkicker’s Music/Rough Trade erschienen.
Der Tonträger geht nun in den Festtagsurlaub und legt am 2. Januar die nächste Platte auf.
…
Weitere Beiträge aus der Serie ÜBER DIE JAHRE
(28) Nena: „Nena“ (1983)
(27) Curtis Mayfield: „Back To The World“ (1973)
(26) Codeine: „The White Birch“ (1994)
(25) The Smiths: „The Queen Is Dead“ (1986)
(24) Young Marble Giants: „Colossal Youth“ (1980)
Hier finden Sie eine Liste aller in der Serie erschienenen Beiträge.
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik