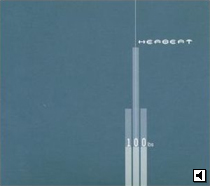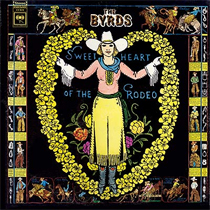Das Londoner Duo Various flicht auf der Platte „The World Is Gone“ sanfte Folkharmonien in seinen fiesen Ganoven-Dub

Vor wenigen Jahren haben die jungen Londoner Clubgänger und ihre DJs wieder einmal einen neuen elektronischen Tanzmusikstil ausgerufen. Aus Two Step und Dub entstand Dubstep. Dröhnende Megabässe mischen zu Samples aus Kung-Fu-Filmen seither den Untergrund auf. Die dumpfe Atmosphärik dieser Musik und ihrer gerne bekifft abhängenden Kundschaft ist jedoch nicht jedermanns Sache.
Seit diesem Herbst wehen neue Gerüchte und andere Töne aus England herüber, das Duo Various versetzt alle in Erregung mit der Geheimniskrämerei um seine Existenz – und mit einer frischen Folkdusche für den schwerfälligen Dubstep. Die beiden Londoner Adam Philips und Ian Carter betreiben ihr eigenes kleines Label Various Productions und ein gut laufendes Tonstudio, mehr lässt sich über die Formation mit dem missverständlichen Namen tatsächlich nicht herausfinden. Ihr erstes Album The World Is Gone ist bebildert mit morbiden erotischen Fantasiezeichnungen, die an die Illustrationen in Oscar Wildes Romanen erinnern. Interviews geben die beiden so gut wie gar keine, wer auf ihrer Platte singt, verschweigen sie beharrlich.
Verwirrung stiften sie wohl gerne. Das Eröffnungsstück Thunnk bollert, eine Stimme erzählt monoton vor bedrohlich zersägten Streicherklängen, das zweite Stück Circle of Sorrow ist eine verstörend schöne Folkballade. Da klampft und klöppelt es nach alter irischer Überlieferung, beinahe denkt man, eine ganz andere CD sei angelaufen. Erst in Hater finden Sängerin und Gangsterfilmakustik näher zueinander, eine hochbrisante Mischung aus Gefahr und zarter Harmonie erwächst.
Mysteriös bleibt der Ursprung der Bedrohung. „Sweet oblivion keeps me alive“ – nur das süße Vergessen lässt mich überleben, singt einer in Soho. Das wiederkehrende Instrumentenriff gleicht in seiner schrillen Penetranz fast tongenau einem Motiv im Soundtrack von Stanley Kubricks Eyes Wide Shut. Dort untermalt es wie ein Alarmsignal den Moment der Gefahr inmitten einer leuchtenden Umgebung: Ein Yuppie-Pärchen wird von pornografischen Albträumen verfolgt und gerät in die Kreise einer rätselhaften Gruppensexsekte. Kurz vor der Katastrophe endet der böse Trip während eines Weihnachtseinkaufs mit der verschämten Rückkehr von Saubermann und -frau alias Tom Cruise und Nicole Kidman in ihre heile Welt.
Bei Kubrick bleibt ein unterschwelliger Rest von Beklemmung – Various wollen es deutlicher. Die verzerrten Glissandi aus Beatbox und Synthesizern fordern finster dröhnend, hämmernd, kreischend: Mehr Albtraum! Albträumen gegen die aufgeräumten Kulturlandschaften voll ihrer kalten Kriege, und womöglich auch gegen eine allzu saubere Musikindustrie, deren Verwertungsmechanismen sie sich so vehement verschließen? Sie befeuern ihre Visionen lyrisch aus den Tiefen folkloristischer Traditionen, aus der Mystik und Mythologie des Dunklen und Unberechenbaren in der Begegnung des Menschen mit der Natur, dem Ursprünglichen und sich selbst. Ausgelebt werden diese Begegnungen jedoch auf einer Ebene modernster Klangerzeugung und den zugehörigen posttraditionalistischen, rebellischen Haltungen.
Im Stück Sweetness beschwören Mann und Frau im Duett eine Art schwarze Messe, in der Abschlussballade Fly dreht gar der schwarze Rabe im Walzertakt die letzte Runde durch die untergehende Welt. Mit ähnlich düsteren Selbstfindungsreisen und elektronisch verhextem Modern Folk macht der ebenfalls aus London stammende junge Teufelsgeiger Patrick Wolf seit zwei Jahren von sich Reden. Selbst im kühlen Synthiepop der Achtziger und Neunziger spukten mitunter recht märchenhafte Folkgespenster. Ein sehr britisches Phänomen, erinnert sei an die ehemalige Lemon-Kids-Sängerin und schillernde Solo-Performerin Danielle Dax und ihren Auftritt im Fantasyfilm Die Zeit der Wölfe.
Doch bevor es zu melodramatisch wird, kommt bei Various der Kick aus der Kammer des magischen Dub-Echos und kitzelt den verträumten Fantasten subsonisch am Zwerchfell: Hey, wir sind auf dem Dance Floor! Mag auch gelegentlich zu viel vom Dope die Atmung und die Bewegungen verlangsamen – ein Groove ist ein Groove – und das hier keine Gruftiegrotte.
„The World Is Gone“ von Various ist als CD und Trippel-LP erschienen bei XL Recordings/Indigo
Auf der ![]() Website des Vertriebs Indigo können Sie Ausschnitte aller zwölf Stücke des Albums hören
Website des Vertriebs Indigo können Sie Ausschnitte aller zwölf Stücke des Albums hören
…
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik