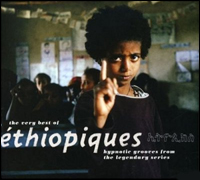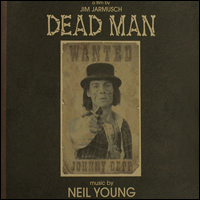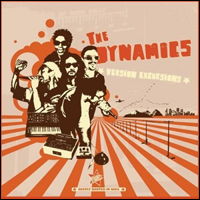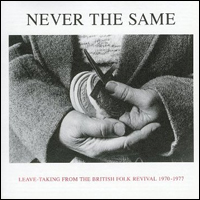Erykah Badu schmiegt sich mit ihrem renitenten Soul in erstaunlich viele Ohren. Ihr neues Album „New Amerykah“ ist ein zuckersüßes Experiment.

Muss man Drogen nehmen, um Drogenmusik zu hören und zu verstehen? Sicherlich nicht. Genau genommen, muss man gar keine Drogen nehmen, denn Musik ist oft Droge genug. Sie kann die Welt auf den Kopf stellen, Naturgesetze außer Kraft setzen und gleichzeitig vorwärts und rückwärts laufen.
„Total bekifft“, denkt man beim ersten Hören von Erykah Badus neuem Album New Amerykah. „Total bekifft“, denkt man auch nach dem zwanzigsten Durchlauf. Der Rhythmus schleppt, das elektrische Klavier nudelt. Richtungslos und schwer zu fassen ist die Musik. Badus soulige Stimme mischt sich dezent dazwischen, statt in den Vordergrund zu drängen. Das Album klingt homogen, seine Einzelteile sind schwer zu greifen. Es macht den Hörer ratlos. Ist das gut oder schlecht? Ist es langsam oder langweilig?
Die Texanerin Erykah Badu ist eine der erfolgreichsten Soulsängerinnen der Gegenwart. Sie ist 37 Jahre alt, vier Grammys schmücken ihre Vitrine, ihre beiden bisherigen Studioalben verkauften sich millionenfach. Ihre Freude am Experiment hat die kommerzielle Strahlkraft nie getrübt. Und so kann sie sich einiges leisten: Das zuckersüße Honey wird zwar als erste Single ausgekoppelt, auf dem Album erscheint es nur als verstecktes Lied ganz am Ende. Sie bricht die Regeln des Marketings, die Irritation schärft ihr Profil. Dem Erfolgsdruck setzt Erykah Badu Krudes entgegen und bewahrt so ihre Eigenständigkeit.
Amerykahn Promise eröffnet das Album mit Funk, der klingt, als hätte man Watte in den Ohren. The Healer schleppt sich geduldig über einen grandiosen Rhythmus des kalifornischen Produzenten Madlib. Zwischen Dub, Reggae, HipHop und indischer Musik pfeifen die Synthesizer und schwelgen die Stimmen. Langsam taucht die Badu ins Unterbewusste ab, die CD läuft, man fiebert aber nicht mit. An Höhepunkten ist New Amerykah arm, zum Gipfel sollen andere streben.
Eingelullt von Flöten, hallenden Stimmen und der kratzigwarmen Stimme seiner Protagonistin frönt man dem musikalischen Rausch – diese Musik ist eine Droge.
„New Amerykah Part One (4th World War)“ von Erykah Badu ist erschienen bei Universal Motown.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie SOUL
Michael Jackson: „Thriller“ (Epic 1982)
„The Very Best Of Éthiopiques“ (Union Square Music 2008)
Curtis Mayfield: „Back To The World“ (Curtom 1973)
Benny Sings: „Benny… At Home“ (Sonar Kollektiv 2007)
Sister Sledge: „We Are Family“ (Atlantic/Warner 1979)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik