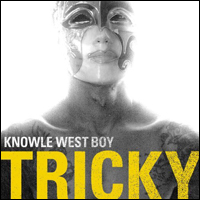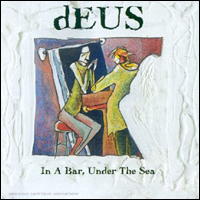Über die Jahre (38): Die New Yorker Band Liquid Liquid nahm Anfang der Achtziger großartige Lieder auf, dann zerbrach sie. Beinahe ihr gesamtes Werk ist nun auf »Slip In And Out Of Phenomenon« nachzuhören.
In der Geschichte der Musik gibt es Gruppen, die immensen Einfluss auf das Nachfolgende ausüben. Und es gibt Gruppen, die verschwinden, bevor sie überhaupt jemand bemerkt hat. Auf das New Yorker Quartett Liquid Liquid trifft beides zu. Wenige Lieder haben sie hinterlassen, doch deren Ruhm überragt den schmalen Korpus. Die Band wird zitiert, kopiert und verehrt. Einer der besten europäischen Clubs, Optimo in Glasgow, hat sich nach einem ihrer Lieder benannt.
Auf den Fotos von früher sieht man vier weiße Jungs in engen Hosen und ranzigen T-Shirts. Sie schauen aus wie großstädtische Künstler, könnten aber ebenso gut Bohrmaschinenvertreter aus New Jersey sein. Was haben diese unlässigen Typen zu tun mit HipHop, Punk und Disco? Alles und nichts. Ihre Rhythmen treiben, scheppernde Kuhglocken erinnern an den Samba, der Bass an den Funk. Der Gesang klingt in keiner Abspielgeschwindigkeit richtig, auf 33 Umdrehungen scheint die Platte zu langsam, auf 45 zu schnell.
Die Beine sagen: »Das ist Disco, Mann! Wir müssen uns bewegen, da rinnt schon Schweiß von den Haaren.« Etwas Unterhalb der Haare meldet sich das Gehirn zu Wort: »Nee, das ist Kunst! Höre auf den Puls dieser seltsamen Klänge. Was wird hier zusammengerührt? Hybrider kann Musik kaum klingen, da ist alles drin. Von Afrika bis Eurasien. Wie der Bass die Melodie führt, das ist purer Krautrock. Und die Melodica? Dub Reggae! Das ist der Schmelztigel New York. Sogar Elliott Sharp spielt bei einem Stück mit. Das ist Avantgarde!« – »Hören wir auf, dies hier in Schubladen zu versenken, tanzen wir!«, fordern die Beine. Und so geschieht es.
Anfang der Achtziger erschienen vier EPs von Liquid Liquid auf dem kleinen Label 99 Records. Die drei ersten werden nun um ein paar unveröffentlichte Lieder angereichert bei Domino Records wiederveröffentlicht, Slip In And Out Of Phenomenon nennt sich die Sammlung. Die im Büchlein zur CD abgedruckten Flugblätter zeigen, dass die Musikszene im New York der frühen Achtziger eng zusammengerückt war. Liquid Liquid spielten mit Sonic Youth, aber auch mit Pionieren des HipHop und des Electro, mit Afrika Bambaataa, den Treacherous Three und Afrika Islam. Das erklärt die Uneindeutigkeit, ja Unverfrorenheit ihres Klangs.
Warum wurde die vierte EP nicht berücksichtigt? Die Band war nicht zufrieden mit den Liedern. Und warum haben sie nie ein ganzes Album aufgenommen? Weshalb erschienen ihre Lieder in diesem Zwischenformat EP? Waren das nur Bestandsaufnahmen, die den Weg in eine jeweils andere Richtung freimachen sollten? Ein Mythos wird zum Mythos, weil er Fragen offenlässt.
Ausgerechnet ihr bekanntestes Stück wurde Liquid Liquid zum Verhängnis: Cavern wurde auf zweifelhaftem Weg vom Disco-Knüller zum Welthit. Der Rapper Grandmaster Flash und seine Furious Five ließen für ihr White Lines das Stück Cavern nachspielen und rappten dazu. An den Einnahmen wollte Flashs Plattenfirma Sugarhill weder Liquid Liquid noch 99 Records beteiligen. Deren Besitzer Ed Bahlman protestierte, wurde bedroht und prozessierte schließlich. Vor Gericht war das eine klare Sache – 99 Records gewann. Doch Sugarhill war bankrott, sie hatten das Geld längst verprasst. Die hohen Anwaltskosten und die Enttäuschung gaben Bahlman den Rest: Sein Label ging pleite und die Band zerbrach.
Im Jahr 1997 veröffentlichten die Firmen Mo’ Wax und Grand Royal Liquid Liquids Platten erneut. Bald darauf meldeten sie Konkurs an. Als läge ein Fluch auf den Platten der Band, wer sie unter die Leute bringt, geht pleite. Nun arbeitet das britische Label Domino Records liebevoll das Werk der Band auf, das ist mutig. In der CD-Version gelingt zwar die Dokumentation des Schaffens, doch gibt es wenig, was darüber hinausweist. Die LP-Ausgabe ist ganz anders angelegt, sie frönt dem Objektfetisch. In einem Schuber stecken die drei EPs in Originalhüllen, dem liegen eine CD mit Liveaufnahmen und ein Begleitheft in Postergröße bei. Das edle Stück ist für rund 20 Euro zu bekommen, Geld wird die Plattenfirma mit so etwas nicht verdienen.
Man muss Domino Records also gleich doppelt Mut bescheinigen, auch wenn sie nur aus Liebe zu den eigenen Beinen handeln.
»Slip In And Out Of Phenomenon« von Liquid Liquid ist auf CD und Dreifach-LP bei Domino Records/Indigo erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Serie ÜBER DIE JAHRE
(37) Nick Drake: „Fruit Tree“ (1979)
(36) The Sonics: „Here Are The Sonics!!!“ (1965)
(35) dEUS: „In A Bar, Under The Sea“ (1996)
(34) Miles Davis: „On The Corner“ (1972)
(33) Smog: „The Doctor Came At Dawn“ (1996)
Hier finden Sie eine Liste aller in der Serie erschienenen Beiträge.
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik