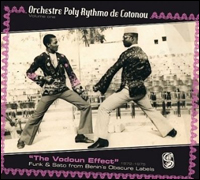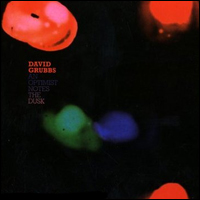Der britische Rapper Roots Manuva ist in den vergangenen Jahren in Vergessenheit geraten. Selbst in der U-Bahn wird er nicht mehr erkannt. „Slime & Reason“ könnte das nun ändern
„Ey du da – hast du mal ein paar Pennies für mich? Meine Frau kriegt ’n Baby und ich muss echt dringend ins Krankenhaus.“
„Klar.“
„Hey Mann, kenn ich dich nicht irgendwoher?“
„Bruder, ich bin auf dieser Insel der erfolgreichste Rapper.“
„Willst du mich verarschen, Opa? Dizzee Rascal und Kano sind die erfolgreichsten Rapper! Wie heißt du denn?“
„Roots Manuva, Bruder. Du kannst mich Rodney nennen, oder einfach Roots. Und ich geb‘ zu, dass meine Erfolge etwas zurückliegen.“
„Roots Malawi? Nie gehört, Mann. Was machst du hier überhaupt in der Londoner U-Bahn? Ich dachte, Rapper fahren dicke Schlitten. Gib mir mal ’ne Kippe und erzähl, machst du noch Musik?“
„Stell erstmal das Gedudel von deinem Handy ab, das macht mich verrückt! OK. Ist zwar schon sieben Jahre her, aber du kennst bestimmt meinen Hit Witness… [Er singt] ‚Witness the fitness, the Cruffiton liveth, one hope, one quest.'“
„Der ist von dir? Nicht schlecht…“
„Danke Bruder. Danach ging’s leider bergab mit den Erfolgen. Ich hab‘ ein paar Alben gemacht, hatte auch immer ’ne Menge Fans, so kam immerhin genug bei rum.“
„OK, und warum fährst du dann U-Bahn?“
„Naja, weißt du, der Luxus lähmt einen, mir ist da einiges zu Kopf gestiegen. Ich hab‘ gerade eine neue Platte aufgenommen und bin immer mit der Bahn ins Studio gefahren, hab‘ mich um alles selbst gekümmert. Ich sag dir, Bruder, das hat meiner Musik gut getan.“
„Muss dann ja eine Wahnsinnsscheibe geworden sein…?“
„Um ehrlich zu sein: War nicht einfach, die Platte zu machen. Es hat sich viel getan im britischen HipHop. Es gibt jetzt Grime und Dubstep. Die haben alle bei mir geklaut, aber das wäre albern, würd‘ ich jetzt auf diese flotten Beats reimen. Ich hab‘ einfach angefangen, wieder meine ganz eigene Musik zu machen und viele grüne Stücke aufzunehmen.“
„Grüne Stücke? Spinnst du?“
„Nein, ich bin doch Synästhet. Unspektakuläre Lieder hab‘ ich gemacht, die sich nicht aufdrängen und bei jedem Hören wachsen. Mit alten Synthesizern und jeder Menge Gesang. Hör’s dir an, Mann, das ist HipHop, der wie eine Plattform funktioniert. Ich hab‘ mich gefühlt wie früher bei den Parties unserer Soundsystems, da wurde echt alles gespielt und gemixt. Da ging es nicht um Abgrenzung, sondern um Offenheit, wir haben zu Reggae, HipHop, Calypso und Rock’n’Roll getanzt.“
„Machst du etwa Weltmusik, Mann?“
„Nix da. Obwohl, Großbritannien ist ja voll von kulturellen Einflüssen. Ich denke, die Leute halten meine Musik genau deshalb für britisch, weil sie offen ist.“
[Roots Manuva holt eine Thermoskanne und zwei Plastikbecher hervor] – „Willst du ’nen Kaffee, Bruder?“
„Ja, Mann, danke. Erzähl weiter!“
„Musst du nicht ins Krankenhaus? Zu deiner Frau?“
„Stimmt, ich muss hier aussteigen!“
„Du bist ein schlechter Lügner.“
„Und du bist wohl ein guter Musiker. Ich kauf mir gleich dein neues Album – wie heißt du noch? Roots Ma…?“
„…NUUUUVA!“
„Slime & Reason“ von Roots Manuva ist als CD und Doppel-LP bei Big Dada/Rough Trade erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie HIPHOP
Stereo MCs: „Double Bubble“ (PIAS/Rough Trade 2008)
Guilty Simpson: „Ode To The Ghetto“ (Stones Throw/Groove Attack 2008)
„An England Story“ (Soul Jazz Records/Indigo 2008)
Buck 65: „Situation“ (Warner 2008)
Missill: „Targets“ (Discograph/Rough Trade 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik