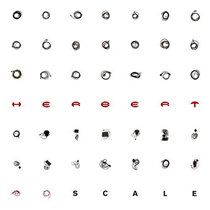Ich düse mit Prinzessin Stéphanie im Cabrio durch Monaco, der Wind verfängt sich in unseren Haaren. Sie trägt ein tolles Kleid in grellem Pink, ein Schlauch aus kleinen elastischen Schlaufen. Ihre Lippen leuchten orangefarben, der Himmel hält azur dagegen. Pfiffe hallen aus den Autos, die wir überholen. Meine Freundin Stéphanie lächelt wissend und winkt ganz elegant und lässig. Ich kann meine Augen nicht von ihr wenden, wie sie will ich auch einmal werden, wenn ich groß bin. Noch bin ich sechs.
Sie blickt mich kokett über den Rand ihrer Sonnenbrille an und dreht das Radio laut: Es spielt Irresistable, ihr Lied! Ich kann noch kein Englisch, also singe ich in meiner Fantasiesprache mit: Shikndaudibell, Shäibiweididell… Wir beide haben einen Riesenspaß und schrauben uns im Cabrio die Serpentinen an der Steilküste empor. Stéphanie zeigt stolz aufs Meer hinaus, da liegt ihre weiße Yacht. Sie plappert vergnügt, plötzlich kommt uns ein Lastwagen entgegen, sie verliert die Kontrolle über das Auto, und wir stürzen den Hang hinunter. Alle Lichter aus.
Vertraute Klänge dringen an mein Ohr, ich schlage die Lider auf. „Stéphanie, bist du’s?!“ „Nein, ich bin Sally Shapiro, deine neue Freundin“, sagt das blonde Mädchen an meinem Bett. Sie spricht Schwedisch und singt Englisch. „Sally? Was ist passiert?“ Sie entgegnet: „Du hast 20 lange Jahre geschlafen, meine Musik hat dich geweckt.“ Dann stimmt sie eine süße Melodie an: I know you’re my love, even though sometimes I believe I will wake up from this dream. Ja, es muss viel Zeit vergangen sein, ich verstehe jedes ihrer Worte und singe gleich mit – ohne Shikndaudibell.
Und doch, diese Musik klingt wie aus den Achtzigern: Metallische Synthesizerflächen bereiten den Grund für beschwingte Ohrwurmlinien, im Hintergrund klötert ein E-Schlagzeug. Duff-Dak, Duff-Dak, Zischschsch. Sally Shapiros Duff-Dak hat mehr Wumms als damals Stéphanie, Sandra oder Limahls Never Ending Story. Er ist in der Gegenwart angekommen und greift neue Elektro-Spielereien auf, mal treibend und sonnig, mal sphärisch und benebelt. Das ist gut gelaunte Melancholie. Stilecht bindet Sally französische Sprechpassagen ein. Sie erzählt von Liebe, Nähe, Sehnsucht und schwelgt im gängigen Repertoire der Poplyrik. Ihre sanfte, kindliche Stimme bewegt sich nach damaliger Mode. Oder ist es die Mode von heute?
Journalisten schreiben von Discotrash, Sally Shapiro besinne sich auf die große Ära der Italo-Disco. Es ist unüberhörbar: Stilelemente der Achtziger erfahren seit einigen Jahren eine Renaissance; Rock, Pop, Elektro mischen mit. Selten aber wurden diese Klänge so konzentriert und charmant wiederbelebt wie auf Sally Shapiros Debütalbum Disco Romance. Die junge Schwedin hat eine Kunstfigur erschaffen, einen Namen gewählt, der nach glitzernden Lurex-Leggins klingt, und die entsprechende Musik drum herum gewoben. Sie ist so schüchtern, ihr ätherisches Stimmchen flattert nur im Studio, und keiner darf dabei sein. Werden wir sie je auf einer hell erleuchteten Disco-Bühne sehen dürfen? Abwarten. Ich jedenfalls nehme schon mal Platz im Cabrio.
„Disco Romance“ von Sally Shapiro ist erschienen bei Klein Records (Diskokaine)
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ELEKTRONIKA
Apparat: „Walls“ (Shitkatapult 2007)
The Student Body Presents: „Arts & Sciences“ (Rubaiyat 2007)
Gudrun Gut: „I Put A Record On“ (Monika 2007)
A&E: „Oi!“ (Sonig 2007)
Alva Noto: „Xerrox Vol. 1“ (Raster Noton 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter zeit.de/musik