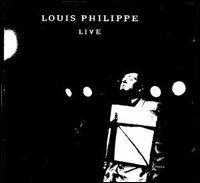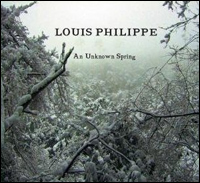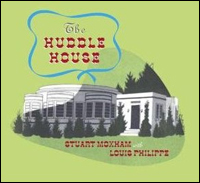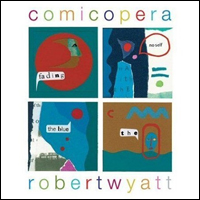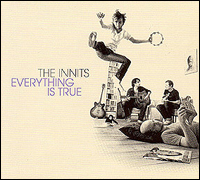
Welch ein Albumtitel! Everything Is True, alles ist wahr. Keine Spur von postmoderner Beliebigkeit. The Innits aus Berlin hauen fröhlich naiv auf ihre Pauken und Gitarren. Dreizehn Stücke sind auf ihrem Debütalbum, zumeist flott und kurz. Es scheppert und kratzt, als wär die Platte dreißig Jahre alt. Ist sie aber nicht.
Der Schlagzeuger singt. Mek Obaam heißt er, in den vergangenen Jahren stand sein Schemel auf der Bühne, wenn Barbara Morgenstern und Schneider TM auftraten. Ein Soloalbum hat er auch aufgenommen vor ein paar Jahren, darauf trommelte er viel. Nun musiziert er mit Band. Auf Konzerten steht sein Schlagzeug ein bisschen weiter vorne als bei anderen Gruppen.
Anfang des Jahres erschien ihre erste Single bei dem irischen Label Earsugar. Everything Is True erblickt nun via Sunday Service in Hamburg das Licht der Welt. In anderen Kritiken fliegen die Referenzen. Die Punker Hüsker Dü klängen an und der Sixties-Beat, The Smiths spielten auf den Instrumenten von Velvet Underground, heißt es. Und der Harmoniegesang? Beatles, früh. Aber so einfach ist das nicht.
Ja, vieles klingt wirklich alt. Einige der Referenzen sind tatsächlich auszumachen. Die musikalischen Anspielungen und Zitate sind so eng mit den Ideen der Band verwoben, dass es sinnlos ist, jeden Ton auf seinen vermeintlichen Ursprung zurückzuführen. Die Innits imitieren nicht, die Sechziger klingen aus ihren Instrumenten auch nach dem Punk der Siebziger, nach dem Pop der Achtziger und Neunziger, nach allem möglichen eben. Tortured Turkeys On The TV blickt in die Vergangenheit durch die Punk-Brille, als hätte die Beatles The Clash gekannt. Country und Calypso im Titelstück ließen sich nur halb so einfach einbauen, wenn nicht der Alternative Country der Neunziger solche Töne vollkommen unironisch rehabilitiert hätte.
Nach dem siebten Stück sollte man eine kleine Pause einzulegen. Am besten holt man sich einen schwarzen Kaffee und eine Zigarette dazu. Die Lieder danach sind ruhiger und düsterer. In die repetitiven Akkorde von Light And Sound kann man tatsächlich The Velvet Underground hineinhören, wenn man will. Und The Smiths? Da ist eine fabelhafte Melodie, da ist ein kluger Text, aber das sind die einzigen Gemeinsamkeiten mit der Band aus Manchester.
So gut sie sich in der Musikgeschichte auskennen: The Innits schaffen etwas eigenes. Everything Is True geht geradeaus. Da sind keine überflüssigen Spielereien, keine spektakulären Schlenker, stattdessen charmante Melodien, wohlige Klänge, mitreißendes Geschepper. Wem das allein zu öde ist, der mag seine Distinktion aus der Aufzählung der unzähligen ausgemachten Referenzen gewinnen. Wäre schade.
„Everything Is True“ von The Innits ist als LP und CD erschienen bei Sunday Service.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Eveline: „Happy Birthday, Eveline!!!“ (Sopot Records 2007)
Louis Philippe: „An Unknown Spring“ & „Live“ (Dandyland 2007)
Stuart Moxham & Louis Philippe: „The Huddle House“ (Dandyland 2007)
Pupkulies & Rebecca: „Beyond The Cage“ (Normoton 2007)
The Mother The Son And The Holy Ghost: „s/t“ (Schinderwies 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik