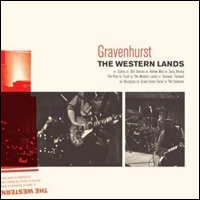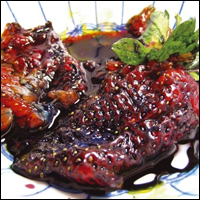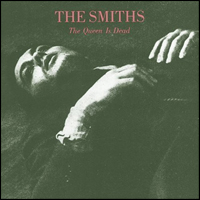Auf ihrer neuen Platte White Chalk kommt PJ Harvey ohne verzerrte Gitarren aus. Ihre betörende Stimme klingt nun aus der fünften Dimension zu uns hinüber. Ein Groschenroman.

Die folgende Geschichte ereignete sich am 17. Oktober 2019 irgendwo südlich des Nordpols. Weshalb das Jahr 2019 in der Vergangenheit liegt? Betrachtet man die Welt in ihren fünf Dimensionen, ergibt das Sinn. Das Jahr 1969 läge dann in ferner Zukunft.
Also weiter. Kapitän Jennings’ Schiff fuhr auf einen Fels und kenterte. „Kapitän“ war nur sein Spitzname, er war ein einfacher Fischer. Aber er war ein guter Fahrer und kannte sich aus in der Gegend.
Jeden Morgen fuhr er mit dem Kutter los. Allein. Über die Jahre hatte er so einiges gefangen, manches verschwieg er seiner Frau lieber. Denn Kapitän Jennings war ein rechter Lump. Gerne legte er in den benachbarten Häfen an, um sich in Hurenhäusern zu vergnügen. An solchen Tagen kaufte er die Fische der Kollegen, um getane Arbeit vorzutäuschen. Außerdem hatte er ein ordentliches Alkoholproblem. Aber das war in seinem Dorf so üblich. Wenn alle das gleiche Problem haben, wird es zur Normalität. Und niemand schaut mehr hin.
Doch was war passiert an jenem 17. Oktober? Entrückte Musik hatte Jennings in fremde Gewässer geführt. Durch den Nebel schallte eine Frauenstimme, blechern und schwindsüchtig. Er vernahm weiche Akkorde eines leicht verstimmten Klaviers. „Dear Darkness. Dear, I’ve been your friend for many years“ – diese Stimme flüsterte und versprach Unheil. Jennings konnte sich ihren Reizen nicht entziehen, wie hypnotisiert steuerte er in sein Verderben. Ächzend barst der Rumpf seines Kutters.
Jennings fand sich in einer Unwelt wieder, ein falscher Kapitän ohne Kutter. Seine Kleidung war durchnässt. Er zitterte und blickte um sich. Er befand sich auf einer winzigen Insel. „Hier könnte man keine zwei Häuser bauen“, dachte Jennings. Das Moos auf dem Gestein war mit Eis überzogen. Der einzige Baum war tot, er trug schon lange keine Blätter mehr. Wenige Meter entfernt lag ein ausgedörrter Schwerenöter, zwei Krähen naschten an ihm. In seinem Blick trug er die Vorahnung eines baldigen Todes. Jennings machte keine Anstalten, dem Siechenden zu helfen. Denn etwas anderes beanspruchte seine Aufmerksamkeit. Es war die Musik. Jennings war gelähmt.
„Der Engel der Vergeltung…“ – der Halbtote keuchte – “Wir sind verloren. Hab acht, schau ihm nicht zu lange in die Augen, denn…“ Zu mehr reichte die Kraft nicht, der Schwerenöter war hin. Jennings verstand gar nichts. Doch wer könnte ihm das in solcher Ausweglosigkeit verdenken? Das Wolkenmeer brodelte. In der Krone des toten Baumes erspähte er eine Frau im weißen Hochzeitskleid. Er wusste jetzt, wessen Stimme ihn benebelt hatte. Und das Rätsel der Augen war ebenfalls gelöst. Er hatte von ihm gehört – der Engel der Vergeltung ist eine Frau. Und sie haut Bilder. Wer zu lange in ihre Augen blickt, erstarrt zu Stein. Und wird später bei Sotheby’s versteigert.
Jennings haderte. Nun bekam er die Quittung für seine Hurereien. Ein Schnaps wäre jetzt gut. Doch hier auf diesem unwirtlichen Eiland gab es nur einen grausamen Engel, dessen Augen Trost spendeten und zur selben Zeit die Höllenpforten öffneten. Der Wind spie Jennings ins Gesicht, und das Kleid der Engelsgestalt flatterte. “Oh God I miss you“, drang es aus ihrem Mund, und ihr Gesicht trug keine Regung. Da gab Jennings nach. Obwohl er wusste, dass dies sein Untergang war, blickte er dem Engel ins Gesicht, es war weiß wie ihr Hochzeitskleid. Mutig ließ er sich in die Wärme seines Blicks fallen – und genoss seinen Tod. Er fühlte, wie er erhärtete. In diesem Augenblick war ihm sein Leben leicht, seine Schuld war nun beglichen. Er war dem Engel ganz nah. Jennings erstarrte.
In ferner Zukunft, am 9. Oktober 1969, wird er gefunden. Ein Forschungsschiff entdeckt acht versteinerte Schwerenöter. Weder ihre Herkunft noch ihre Todesursache können geklärt werden. Die Steinmenschen werden an Museen in aller Welt verkauft.
„White Chalk“ von PJ Harvey ist als CD und LP bei Island Records/Universal erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Gravenhurst: „The Western Lands“ (Warp Records 2007)
The Bravery: „The Sun And The Moon“ (Island Records 2007)
Animal Collective: „Strawberry Jam“ (Domino Records 2007)
Hard-Fi: „Once Upon A Time In The West“ (Warner Music 2007)
The Smiths: „The Queen Is Dead“ (Sire/Warner Music 1986)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter zeit.de/musik