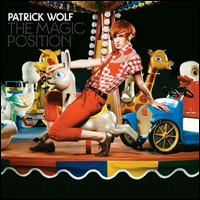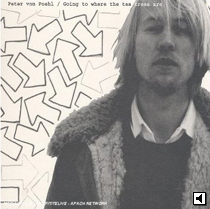Stuart Moxham spielt auf seiner Gitarre rhythmische Muster, sein Bruder Philip auf dem Bass die Melodie dazu. Eine Rhythmus-Maschine tuckert, gelegentlich kommt von der Orgel eine traurige Melodie, und Alison Statton singt charmant dazu. Als Colossal Youth von den Young Marble Giants im März 1980 erscheint, ist es eine kleine Sensation. Punk ist eben vorbei, und jetzt gibt es kaum jemanden, der sich nicht sofort in die Band verliebt.
Das Trio aus Cardiff in Wales existierte damals bereits seit zwei Jahren. Die Moxham-Brüder waren hagere, kurzhaarige Jungs, Zigaretten in den Mundwinkeln. Alison, die Sängerin, trug ein Mädchen-Kostüm auf, buntes Kleid, weiße Söckchen, Turnschuhe. Das schattige Foto auf der LP und die schlichte Gestaltung der Hülle versprachen Melancholie und Freudlosigkeit. Und in gewisser Weise erinnert die Musik der Young Marble Giants auch an Bands wie Joy Division und The Passage: in ihrer Kargheit und ihrem Ernst. Da ist nichts unkontrolliert oder wütend, da schäumt nichts über wie bei der Pop Group, The Slits oder The Raincoats.
Das Jahr 1980 war reich an neuen Klängen und wagemutigen Platten, das Album Colossal Youth aber sollte keine Grenzen überschreiten. Die Stücke waren kurz und eingängig. Sie verströmten eine Leichtigkeit, die selten war in dieser Zeit. Der Gesang Stattons klang beiläufig, so als würde sie nur für sich singen. Als sie am Ende des Jahres im Leser-Pool des New Musical Express in der Kategorie Beste Sängerin den achten Platz belegte, wunderte sich Stuart Moxham. Es heißt, er sei zunächst dagegen gewesen, die Freundin seines Bruders in die Band aufzunehmen: „Alison ist keine Sängerin! Alison singt, als wäre sie an der Bushaltestelle oder sonst wo.“
Es ist die Einfachheit und Selbstverlorenheit, die Abwesenheit von Kunstwollen und Virtuosität, die den bleibenden Charme der Young Marble Giants ausmacht. In ihrer Musik verbinden sie unvereinbar scheinende Einflüsse. Stuart Moxhams resonanzloser, abgehackter Gitarren-Klang hat etwas vom frühen Rock’n’Roll – den Twang Duanne Eddys, die Rhythmik Eddie Cochrans. Philip Moxhams Bass führt häufig die Melodie, er klingt wie eine zweite Gitarre. Ungewöhnliches ist die Orgel mit der eingebauten Rhythmusmaschine. Sie klingt wie eine Referenz an die Musik, die das britische Fernsehen zum Testbild spielte, wenn das Abendprogramm vorbei war.
Die Young Marble Giants veröffentlichten noch die instrumentale Testcard E.P. und die Single Final Day, dann lösten sie sich auf. Das letzte Stück war ein Kinderlied über die Apokalypse. Stuart Moxham soll es in der Zeit geschrieben haben, die man braucht, es anzuhören: in 1 Minute und 39 Sekunden.
„Colossal Youth“ von den Young Marble Giants ist im Jahr 1980 bei Rough Trade erschienen. Soeben wurde das Album bei Domino Records als LP und Doppel-CD wiederveröffentlicht. Die zweite CD enthält neben Demo-Versionen der Stücke des Albums sowohl die „Testcard E.P.“ als auch die drei Songs der „Final Day“-Single. Eine limitierte Dreifach-CD enthält zusätzlich die Peel Session der Band.
…
Weitere Beiträge aus der Serie ÜBER DIE JAHRE
(23) Sister Sledge: „We Are Family“ (1979)
(22) Rechenzentrum: „The John Peel Session“ (2001)
(21) Sonic Youth: „Goo“ (1990)
(20) Flanger: „Spirituals“ (2005)
(19) DAF: „Alles ist gut“ (1981)
(18) Gorilla Biscuits: „Start Today“ (1989)
(17) ABC: „The Lexicon Of Love“ (1982)
(16) Funny van Dannen: „Uruguay“ (1999)
(15) The Cure: „The Head On The Door“ (1985)
(14) Can: „Tago Mago“ (1971)
(13) Nico: „Chelsea Girl“ (1968)
(12) Byrds: „Sweetheart Of The Rodeo“ (1968)
(11) Sender Freie Rakete: „Keine gute Frau“ (2005)
(10) Herbie Hancock: „Sextant“ (1973)
(9) Depeche Mode: „Violator“ (1990)
(8) Stevie Wonder: „Music Of My Mind“ (1972)
(7) Tim Hardin: „1“ (1966)
(6) Cpt. Kirk &.: „Reformhölle“ (1992)
(5) Chico Buarque: „Construção“ (1971)
(4) The Mothers of Invention: „Absolutely Free“ (1967)
(3) Soweto Kinch: „Conversations With The Unseen“ (2003)
(2) Syd Barrett: „The Madcap Laughs“ (1970)
(1) Fehlfarben: „Monarchie und Alltag“ (1980)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik