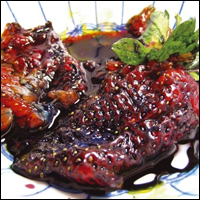Mit kratzender Stimme erzählt der amerikanische Folksänger Vic Chesnutt Geschichten voller Menschlichkeit. Sein Album „North Star Deserter“ strahlt eine unheimliche Ruhe aus.
Vic Chesnutts Alben stecken voller Geschichten. Er ist ein begnadeter Erzähler alltäglicher Dramen, auch seiner eigenen. North Star Deserter heißt sein elftes Album.
Er wurde in Florida geboren, heute lebt er einen Bundesstaat weiter nördlich, in Georgia. 43 Jahre ist er alt und an den Rollstuhl gefesselt. Im Jahr 1983 hatte er einen Autounfall, seitdem ist seine untere Körperhälfte gelähmt. Er war betrunken von der Straße abgekommen.
Mitte der Neunziger widmete ihm die karitative Organisation Sweet Relief ein Benefiz-Album. Eine illustre Musikerschar sang seine Stücke nach, R.E.M. waren dabei und die Smashing Pumpkins, Madonna, Soul Asylum und Garbage. Da rockten und fiepten seine kargen Lieder plötzlich, das klang nicht immer gut.
Viele Fotos zeigen Vic Chesnutt mit seiner Gitarre auf den Knien. Zynisch kommentiert er seinen Rollstuhl, wenn er auf der Bühne ist. Dann lacht er über sich selbst, keine Spur der Verbitterung. Aus seinen Texten spricht Menschlichkeit. Sie sind direkt, nur selten bemüht er Metaphern. Viele seiner Worte klingen, als dichte er über sich selbst, doch seine Offenheit ist nie aufdringlich.
Warm ist der erste Titel auf seinem neuen Album. Zu den sparsamen Tönen der Gitarre singt er von der Wärme des Körpers, vom Zucken der Muskeln, vom Leben mit einer schlechten Nachricht. „What is the message on those gamma rays that are a’penetrating you? Do they say that the end it is a’coming soon? Or do they say ‚Forget the sun, worship the moon‘? But whatever it is, our pinhole perspective cannot a’translate sufficiently“, dichtet er. Mit der Krankheit macht sich die Angst und das Ungewisse im Alltag breit. „Anyway, A or B, you know, it’s alright with me“, schließt er. Was soll man auch tun?
In der schlicht instrumentierten Strophe von You Are Never Alone erzählt er von Abtreibung, Bypass-Operationen, von den Medikamenten Valtrex, Prilosec und Vioxx. Das sei alles schlimm, aber in Ordnung, schließlich müsse es weitergehen. Das versichert auch ein Chor im schunkeligen Refrain.
Vic Chesnutts nasale Stimme kratzt und ächzt. Sie steht im Mittelpunkt der Stücke und verleiht ihnen eine unheimliche Ruhe. Nur bei Everything I Say und Debriefing bricht die Oberfläche auf, und die Band wird richtig laut.
Welche Band eigentlich? Die meisten seiner bisherigen Alben hat Vic Chesnutt auf seiner Gitarre eingespielt, brüchige Folkstücke ohne Schmalz. Diesmal huschte eine ganze Schar befreundeter Musiker durch das Studio in Montreal. Die zwölfköpfige Truppe setzte sich zusammen aus Mitgliedern von Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra & Tra-La-La Band, Frankie Sparo, Hangedup und Godspeed You! Black Emperor, allesamt Hausbands des kanadischen Labels Constellation Records. Guy Picciotto von der amerikanischen Punkband Fugazi brachte seine Stimme und sein Gitarrenspiel ein. Auch die Geister des Poeten W. H. Auden, des Malers Philip Guston und der Sängerin Nina Simone seien eingeladen gewesen, schreibt der Produzent des Albums, der Filmemacher Jem Cohen.
Den Geist Nina Simones meint man sogar zu hören. Wenn Chesnutt ihr Stück Fodder On Her Wings interpretiert, klingt ihre tieftraurige Stimme mit. Die Taube, die die Hülle von Chesnutts Albums ziert, ist wohl diesem Lied entflogen. „A bird fell to earth / Reincarnated from her birth / She had fodder in her wings / She had dust inside her brains“, heißt es darin. „She watched the people how they lived / They’d forgotten how to give / They had fodder in their brains / They had dust inside their wings.“ So sind sie eben, die Menschen, würde Chesnutt wohl schließen. Nina Simone sang: „Oh, how sad, how sad“.
„North Star Deserter“ von Vic Chesnutt ist als CD und Doppel-LP bei Constellation Records erschienen
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie FOLK
Colleen: „Les Ondes Silencieuses“ (The Leaf Label/Indigo 2007)
A Hawk And A Hacksaw: „The Way The Wind Blows“ (The Leaf Label/Hausmusik 2007)
Audrey: „Visible Forms“ (Sinnbus 2006)
Markku Peltola: „Buster Keaton Tarkistaa Lännen Ja Idän“ (Klangbad 2006)
Victory At Sea: „All Your Things Are Gone“ (Gern Blandsten 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter zeit.de/musik