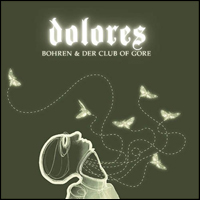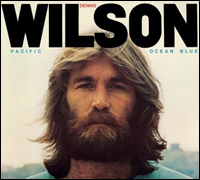Seit einigen Jahren lässt die Deutsche Grammophon ihre Klassik auf Pop trimmen. Die Technoproduzenten Carl Craig und Moritz von Oswald nahmen sich nun Ravel und Mussorgsky zur Brust
Begegnen sich Klassik und elektronische Clubmusik, reagieren Puristen meist skeptisch. Dabei besteht – anders als in der Rockmusik, in der das Orchester vor allem Schmuck ist – hier noch eine ästhetische Übereinkunft. Beide Stilrichtungen sind gleichermaßen an Klangforschung und an Texturen interessiert, die mit Hörgewohnheiten brechen. Beiden wohnt das Eigenbrötlerische inne und die ewige Last, sich nur dem Fachpublikum wirklich zu öffnen. Trotz gegenseitigen Respekts und dieser Gemeinsamkeiten gehen Klassik und Clubmusik sich lieber aus dem Weg. Umso erfreulicher ist es, wenn jemand den Graben überwindet.
Die Serie Recomposed der Deutschen Grammophon basiert auf der Idee des Brückenschlags. Die Reihe soll Klassik clubtauglich machen. Angesagte Pop-Produzenten dürfen sich Stücke aus dem Katalog des Klassiklabels aussuchen und sie neu mischen. So bearbeitete bereits der Hamburger Produzent Matthias Arfmann Aufnahmen der Berliner Philharmoniker, und der finnische Techno-Kabarettist Jimi Tenor tobte sich an Werken der Neuen Klassik aus.
Die dritte Ausgabe der Serie bestreiten nun die Technoproduzenten Carl Craig und Moritz von Oswald. Ein Coup der Deutschen Grammophon, zu Recht gelten sie als zwei der wichtigsten Protagonisten der elektronischen Tanzmusik. Mit seinen experimentellen Stücken zwischen Techno, Jazz und Soul prägte Carl Craig aus Detroit das Genre, Moritz von Oswald erfand im Berlin der frühen neunziger Jahre den Dub-Techno und veröffentlicht auf dem Label Rhythm & Sound minimale Bassmusik zwischen Roots-Reggae und Dub. Zusammen bearbeiten sie nun Maurice Ravels Bolero und seine Rhapsodie Espagnole, sowie Ausschnitte aus dem Zyklus Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky und reduzieren sie auf minimale Erkennungsmerkmale, kombiniert mit eigenen Klängen. Das Ergebnis ist ein in sich geschlossenes Musikstück in sechs Sätzen.
Oberflächlich betrachtet haben Vorlage und Neubearbeitung nicht viel gemein. Zu Beginn der Re-Komposition steht eine sanft gleitende Einleitung melancholischer Synthesizer-Akkorde. Erst nach vier Minuten schält sich der markante Rhythmus des Bolero heraus. Die Musiker lassen sich viel Zeit: Sparsam eingesetzte Elemente geraten erst nach und nach in Bewegung, einzelne Klänge treten hervor, etwa die Solotrompete aus Mussorgskys Bilder einer Ausstellung.
Das endlose Steigerungsprinzip der Kompostion Ravels betonen Carl Craig und Moritz von Oswald, indem sie mikroskopische Klangeinheiten immer wieder neu kombinieren. Erst mit dem Einsatz der Basstrommel verlässt der Bolero das klassische Terrain – er ist zu einem treibenden Technostück mutiert, dessen repetitive Klänge sich ineinander schrauben. Die Parallelen zwischen U- und E-Musik sind hörbar – nahezu unbemerkt haben die beiden Arrangeure die Clubmusik mit der abendländischen Klassik in Einklang gebracht.
Erst im fünften Satz sind die Originalaufnahmen der Berliner Philharmoniker zum ersten Mal deutlich zu hören. Dunkel und schwer arbeitet sich das Prélude A La Nuit der Rhapsodie vorwärts, Carl Craig und Moritz von Oswald setzen es mit Pausen und Hallschleifen effektvoll in Szene. Die Musiker schaffen einen faszinierenden Spannungsbogen, das geheimnisvolle Motiv dreht sich um sich selbst, und mündet schließlich in einen fiebrigen Dub-Techno.
Im letzten Satz kommt die Re-Komposition wieder zur Ruhe: Die Orchesterspuren kreisen wie hungrige Vögel über afrikanischer Perkussion. Das Experiment endet offen, Carl Craig und Moritz von Oswald improvisieren mit elektronischen Klängen und rhythmischen Effekten. Der Klang verhallender Trommeln beschließt die Platte, das ist schlüssig. Schließlich haben Trommeln noch jeden musikalischen Graben überwunden.
„Recomposed“ von Carl Craig & Moritz von Oswald ist bei Deutsche Grammophon/Universal erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ELEKTRONIKA
Morgan Geist: „Double Night Time“ (Environ/Alive 2008)
Milosh: „iii“ (K7/Alive 2008)
Flying Lotus: „Los Angeles“ (Warp/Rough Trade 2008)
Matmos: „Supreme Balloon“ (Matador/Beggars Banquet 2008)
Kelley Polar: „I Need You To Hold On While The Sky Is Falling“ (Environ/Alive 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik