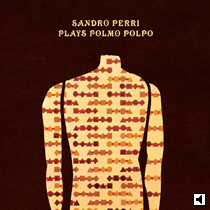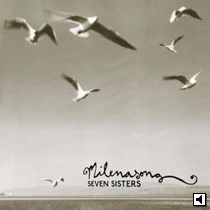Die Brazilian Girls singen auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Und warum auch nicht? Hier kommt „Talk To La Bomb“…
In welche Schublade soll man die Brazilian Girls stecken? Ihr erstes Album aus dem Jahr 2005 klang nach dieser neuen brasilianischen Popmusik, die viel mit elektronischen Elementen arbeitet. Der Keyboarder und Programmierer Didi Gutman hatte auch schon mit Bebel Gilberto zusammengearbeitet. Das zweite Album Talk To La Bomb ist schwerer einzuordnen. Ist das tanzbare Loungemusik? Seichter House? Vielleicht Jazz? Einfach Pop? Die Sängerin Sabina Sciubba stört die Uneindeutigkeit nicht: „Wir sind nicht mehr von brasilianischer Musik beeinflusst als von argentinischer oder afrikanischer oder europäischer Musik“.
Aber der Name? Der ist nur ein Witz. Keiner der vier Musiker kommt aus Brasilien. Didi Gutman kommt aus Buenos Aires, der Bassist Jesse Murphy aus Kalifornien und der Schlagzeuger Aaron Johnston aus Kansas. Und das einzige Girl im Bunde, Sabina Scubbia, ist überall ein bisschen zu Hause. Geboren wurde sie in Rom, aufgewachsen ist sie in München und Nizza, seit einigen Jahren lebt sie in New York.
Das Telefoninterview führt sie aus ihrem Urlaub in Puerto Rico. Im Hintergrund zwitschern die Vögel. In den Stücken wechselt sie die Sprache – Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch – manchmal mitten in einer Strophe. Die Plattenfirma wollte sie auf eine Sprache festlegen, berichtet sie. Verstanden habe sie das nicht, und befolgt schon gar nicht: „Ich kenne mittlerweile so viele Menschen, die mehrere Sprachen sprechen. Ich glaube nicht, dass es problematisch ist, mehrsprachig zu singen“.
Genauso unbekümmert wie sie klingt das zweite Album ihrer Band, Talk To La Bomb. Vom harschen ersten Stück Jique war die Plattenfirma ebenfalls nicht begeistert, sie wünschte sich eine weitere Portion des musikalischen Sonnenscheins vom ersten Album.
Ihre Musik ist wilder geworden. Der agile Bass umspielt die programmierten Beats, als würde er versuchen, ihnen ein Schnippchen zu schlagen. Große Teile der Musik sind in spontaner Improvisation entstanden, wie kleine Wunder verbinden sich die Elemente doch immer wieder zu Liedern, die melodisch sind, aber stets voller Brüche und Stolpersteine. Man hört, dass alle vier Musiker ihre Wurzeln im Jazz haben, kennen gelernt haben sie sich in einem New Yorker Jazzclub. Immer wieder setzen sich einem Textstellen und musikalische Phrasen im Kopf fest, hier und da klingt etwas bekannt.
Das Album ist sehr spontan im Studio entstanden. Nur für ein Stück holten sie sich einem Produzenten dazu. Ihre eigene Version von Last Call gefiel ihnen nicht, so machte Ric Ocasek eine Disconummer im Stil der Achtziger draus. Und siehe da, sie steht den Brazilian Girls ausgezeichnet, wie eigentlich alles was, sie an- und ausprobieren.
„Talk To La Bomb“ von den Brazilian Girls ist als CD erschienen bei Verve Forecast/Universal
Hören Sie hier ![]() „Never Met A German“ und die beiden auf Deutsch neu aufgenommenen Stücke
„Never Met A German“ und die beiden auf Deutsch neu aufgenommenen Stücke ![]() „Jique“ und
„Jique“ und ![]() „Last Call“
„Last Call“
…
Lesen Sie hier: Die Platten des Jahres 2006 – Eine Nachschau auf 100 Tonträger
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Milenasong: „Seven Sisters“ (Monika 2007)
The Cure: „Festival 2005“ (Geffen/Universal 2006)
Gwen Stefani: „The Sweet Escape“ (Universal 2006)
Sodastream: „Reservations“ (Hausmusik 2006)
Sufjan Stevens: „Songs For Christmas Singalong“ (Asthmatic Kitty/Cargo 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik